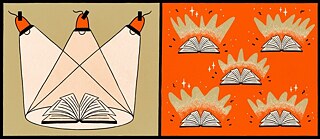Learn German
Experienced teaching ensures your success

Learn German from the market leader. We offer German language courses and exams in over 90 countries.
Explore
Discover our work
Teaching German
Our offices in London and Glasgow are committed to high-quality in-service training for German teachers. We offer free classroom materials, digital teaching programmes, training courses, scholarships and much more. Find out more about our offers, including the new educational initiative GIMAGINE, and get in touch with our staff.

Visit us
Our branches in the UK
The Goethe-Institut has branches in London and in Glasgow: the Goethe-Institut London opened in South Kensington in 1962 and the Goethe-Institut Glasgow was founded in 1973.