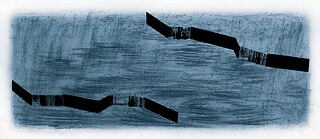Bald wird alles gut
Mein Großvater hatte ein altes Radio, das im Haus unserer Großfamilie in der Provinz Kandahar stand. Er saß den ganzen Tag davor und hörte die paschtunisch-sprachigen Programme von BBC oder Voice of America über Kurzwelle. Ich setzte mich manchmal zu ihm, um die Nachrichten über die schrecklichen Ereignisse damals in den Neunzigern zu hören. Mit gefiel die markante Stimme von Nabi Misdaq, dem Gründer der paschtunischen Sparte von BBC, wenn er sagte: „Sie hören BBC Paschto aus London“. Danach trug ich meiner Familie die Nachrichten vor, die ich gehört hatte und versuchte dabei, seinen Tonfall tu imitieren. In dieser Zeit entdeckte ich meine Liebe zum Journalismus. Ich fragte mich, wie ein Radiostudio aussah, oder die Menschen, deren Stimmen mir so vertraut waren.
Jahre später, als ich mich auf die Aufnahmeprüfung an der Universität vorbereitete, erzählte ich meinem Vater von meiner Berufswahl. Er hatte mich bis dahin in jeder meiner Entscheidungen unterstützt, doch mit dieser war er ganz und gar nicht glücklich. Ich kann es ihm nicht verdenken, denn ich habe zu oft erlebt, wie junge Journalisten in Kandahar zur Zielscheibe wurden oder ums Leben kamen. Doch irgendwie konnte ich meine Familie überzeugen und begann meinen Bachelor-Studiengang. Nach dem Abschluss kam ich nach Indien, um mit Hilfe eines Stipendiums an einer renommierten Universität in der Hauptstadt meinen Master zu erlangen. Hier bin ich nun und sehe Afghanistan regelmäßig in den Schlagzeilen.
Ich bin auch in einer Hauptstadt aufgewachsen, doch nicht in Kabul, wie man vielleicht vermuten könnte. Ich kam 1996 zur Welt, gerade als die Taliban in Afghanistan die Macht übernahmen, und Kandahar, die Stadt meiner Geburt, war ihre Hauptstadt. Meine erste Schule war eine Madrasa. Wir hatten damals nicht viel. Unsere größte Freude war es, mit Steinen und Stöcken in einem Kreis auf dem Boden zu spielen. Ich war acht Jahre alt, als ich zum ersten Mal im Haus von Verwandten ein Fernsehgerät sah. Meine Mutter lacht noch immer darüber. Ich war völlig fassungslos und rief: „Mama, was ist das?“
Heute musste ich an diese Worte denken, als ich eine Stunde vor einer Vorlesung an meiner Universität in Delhi aufwachte. Wie immer las ich, noch bevor ich aus dem Bett aufstand, in meinen sozialen Medien. Die sozialen Medien sind in Afghanistan die wichtigste Nachrichtenquelle, denn traditionelle Medien können viele Konfliktgebiete nicht erreichen. Deshalb verlassen sich die Menschen dort vor allem auf Informationen, die ihre Landsleute selbst hochladen.
Das erste, was ich auf Facebook sah, waren Nachrichten und Fotos von Angriffen auf meine alte Nachbarschaft und mein Elternhaus. Es folgten Posts mit Bildern von Verletzten und zerstörten Gebäuden in unserem Viertel. Mit zitternden Händen und klopfendem Herzen versuchte ich, meine Mutter anzurufen, doch niemand meldete sich.
Es war neun Uhr morgens. Nach mehreren vergeblichen Versuchen begann ich, die Hoffnung aufzugeben. Ich scrollte hilflos durch die Nachrichten und dachte an meine schwere Vergangenheit und meine unsichere Zukunft.
Ich kann mich noch genau an den Zusammenbruch des Taliban-Regimes im Jahr 2001 erinnern. Als die erste US-Rakete in Kandahar einschlug, bebte unser ganzes Haus und mehrere Fenster gingen zu Bruch. Ich sehe noch den blendend weißen Blitz am Himmel vor Augen.
Als die neue Regierung gebildet war, schrieb mich mein Großvater an einer öffentlichen Schule nahe unseres Hauses ein. Das neue Gebäude, die übervollen Klassenräume und die frisch gedruckten Bücher erschienen uns wie ein Wunder. Später ging ich auf eine Highschool, die mit türkischer Unterstützung im Zentrum von Kandahar betrieben wurde, in der Nähe von mehreren wichtigen Regierungsgebäuden. Die Gewalt hielt weiter an. Selbstmordattentate und Bombenanschläge waren an der Tagesordnung und ständiges Gesprächsthema. Eines Tages, während der Nachmittagspause, stiegen Bewaffnete auf das fünfstöckige Gebäude gegenüber unserer Schule und begannen wild um sich zu schießen. Durch den Kugelhagel führten die türkischen Lehrkräfte uns Schüler ins Erdgeschoss. Hunderte von Schüssen trafen Fenster und Mauern der Schule. Doch wir scherzten mit unseren Klassenkameraden und lachten über unsere verängstigten ausländischen Lehrer, die uns anschrien, still zu sein. Im Rückblick erscheint mir unser Verhalten in dieser gefährlichen Situation bizarr, doch damals war es Normalität für uns. Vielleicht war es Selbstschutz - zu lachen, wenn der Tod so nahe war, wenn Menschen rings um uns starben. Wir bekamen nicht frei wegen des Angriffs. Am nächsten Tag waren wir zurück in der Schule, zählten die Einschüsse und sammelten Patronenhülsen auf.
Trotz all dessen genoss ich mein Leben mit meinen Freunden. Gemeinsam herumzuhängen war das einzige, was uns ablenkte, doch in Kandahar gab es dafür kaum sichere Orte. Als Teenager musste ich, um die Stadt zu verlassen, jedes Mal meinen Vater um Erlaubnis bitten, die er mir meist verweigerte. Also ging ich ohne Wissen meiner Familie.
Heute, als ich sie nicht erreichen konnte, erinnerte ich mich an einen jener Tage. Wir hatten schulfrei und ich traf mich mit meinen Klassenkameraden vor der Schule, um mit ihnen zu einem Ausflugsort außerhalb der Stadt zu ziehen. Auf dem Nachhauseweg fiel mir auf, dass mich seit Stunden niemand angerufen hatte. Ich blickte auf mein Mobiltelefon und sah, dass die Batterie leer war.
Als ich um acht Uhr abends zuhause ankam, stand meine ganze Familie vor dem Haus. Ich bekam es mit der Angst zu tun - etwas Schreckliches musste passiert sein. Mein Vater fragte mich wütend, wo ich gewesen sei. „Mit Freunden unterwegs“, antwortete ich. Er sagte: „Ich habe die ganze Stadt, alle Krankenhäuser und Polizeiwachen nach dir abgesucht.“
Sie dachten, mir wäre etwas zugestoßen. Wenn man in Afghanistan ausgeht, ruft einen die Familie ständig an, bis man wieder zu Hause ist. Wenn man nicht ans Telefon geht, beginnt sie, in Krankenhäusern und auf Polizeiwachen nachzuforschen. Geht man abends aus, bleibt die Mutter auf, bis man zurückkehrt.
Daran musste ich denken, bis ich meine Familie endlich erreichte.
Wenn ich heute mit meiner Familie telefoniere, höre ich jedes Mal Schüsse im Hintergrund. Die Kämpfe sind auf ihrem Höhepunkt, ständig schlagen Raketen und Kugeln in der Umgebung ein. Jeden Tag werden Häuser in der Nachbarschaft aufgegeben, jeden Tag fliehen Menschen. Doch viele, wie meine Familie, können nicht fliehen. Ihr Haus würde ausgeraubt oder zerstört, wie das im Krieg nun einmal der Fall ist. Doch sie können auch nicht bleiben. Nicht, ohne ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Meine Familie befindet sich in derselben Situation wie viele afghanische Zivilisten. Als ältestes Kind meiner Eltern mache ich mir oft Vorwürfe, weil ich sie nicht beschützen kann. Wann immer ich mit ihnen spreche, bitten sie mich um Rat in einer Sache, die sie nicht selbst entscheiden wollen. Jedes Mal muss ich eingestehen, dass ich es auch nicht besser weiß.
Ich kann ihnen nur sagen, dass bald alles gut wird, und sie antworten mit denselben Worten. Es sind dieselben klischeehaften Worte, die mein Großvater meinem Vater vorsagte. Nun tauschen wir sie aus - und nichts hat sich geändert.
— Juli 2021
Jahre später, als ich mich auf die Aufnahmeprüfung an der Universität vorbereitete, erzählte ich meinem Vater von meiner Berufswahl. Er hatte mich bis dahin in jeder meiner Entscheidungen unterstützt, doch mit dieser war er ganz und gar nicht glücklich. Ich kann es ihm nicht verdenken, denn ich habe zu oft erlebt, wie junge Journalisten in Kandahar zur Zielscheibe wurden oder ums Leben kamen. Doch irgendwie konnte ich meine Familie überzeugen und begann meinen Bachelor-Studiengang. Nach dem Abschluss kam ich nach Indien, um mit Hilfe eines Stipendiums an einer renommierten Universität in der Hauptstadt meinen Master zu erlangen. Hier bin ich nun und sehe Afghanistan regelmäßig in den Schlagzeilen.
Ich bin auch in einer Hauptstadt aufgewachsen, doch nicht in Kabul, wie man vielleicht vermuten könnte. Ich kam 1996 zur Welt, gerade als die Taliban in Afghanistan die Macht übernahmen, und Kandahar, die Stadt meiner Geburt, war ihre Hauptstadt. Meine erste Schule war eine Madrasa. Wir hatten damals nicht viel. Unsere größte Freude war es, mit Steinen und Stöcken in einem Kreis auf dem Boden zu spielen. Ich war acht Jahre alt, als ich zum ersten Mal im Haus von Verwandten ein Fernsehgerät sah. Meine Mutter lacht noch immer darüber. Ich war völlig fassungslos und rief: „Mama, was ist das?“
Ich erinnere mich, wie mein Großvater damals zu meinem Vater sagte: „Bald wird alles gut.“ Und mein Vater erwiderte dasselbe.
Heute musste ich an diese Worte denken, als ich eine Stunde vor einer Vorlesung an meiner Universität in Delhi aufwachte. Wie immer las ich, noch bevor ich aus dem Bett aufstand, in meinen sozialen Medien. Die sozialen Medien sind in Afghanistan die wichtigste Nachrichtenquelle, denn traditionelle Medien können viele Konfliktgebiete nicht erreichen. Deshalb verlassen sich die Menschen dort vor allem auf Informationen, die ihre Landsleute selbst hochladen.
Das erste, was ich auf Facebook sah, waren Nachrichten und Fotos von Angriffen auf meine alte Nachbarschaft und mein Elternhaus. Es folgten Posts mit Bildern von Verletzten und zerstörten Gebäuden in unserem Viertel. Mit zitternden Händen und klopfendem Herzen versuchte ich, meine Mutter anzurufen, doch niemand meldete sich.
Es war neun Uhr morgens. Nach mehreren vergeblichen Versuchen begann ich, die Hoffnung aufzugeben. Ich scrollte hilflos durch die Nachrichten und dachte an meine schwere Vergangenheit und meine unsichere Zukunft.
Ich kann mich noch genau an den Zusammenbruch des Taliban-Regimes im Jahr 2001 erinnern. Als die erste US-Rakete in Kandahar einschlug, bebte unser ganzes Haus und mehrere Fenster gingen zu Bruch. Ich sehe noch den blendend weißen Blitz am Himmel vor Augen.
Als die neue Regierung gebildet war, schrieb mich mein Großvater an einer öffentlichen Schule nahe unseres Hauses ein. Das neue Gebäude, die übervollen Klassenräume und die frisch gedruckten Bücher erschienen uns wie ein Wunder. Später ging ich auf eine Highschool, die mit türkischer Unterstützung im Zentrum von Kandahar betrieben wurde, in der Nähe von mehreren wichtigen Regierungsgebäuden. Die Gewalt hielt weiter an. Selbstmordattentate und Bombenanschläge waren an der Tagesordnung und ständiges Gesprächsthema. Eines Tages, während der Nachmittagspause, stiegen Bewaffnete auf das fünfstöckige Gebäude gegenüber unserer Schule und begannen wild um sich zu schießen. Durch den Kugelhagel führten die türkischen Lehrkräfte uns Schüler ins Erdgeschoss. Hunderte von Schüssen trafen Fenster und Mauern der Schule. Doch wir scherzten mit unseren Klassenkameraden und lachten über unsere verängstigten ausländischen Lehrer, die uns anschrien, still zu sein. Im Rückblick erscheint mir unser Verhalten in dieser gefährlichen Situation bizarr, doch damals war es Normalität für uns. Vielleicht war es Selbstschutz - zu lachen, wenn der Tod so nahe war, wenn Menschen rings um uns starben. Wir bekamen nicht frei wegen des Angriffs. Am nächsten Tag waren wir zurück in der Schule, zählten die Einschüsse und sammelten Patronenhülsen auf.
Trotz all dessen genoss ich mein Leben mit meinen Freunden. Gemeinsam herumzuhängen war das einzige, was uns ablenkte, doch in Kandahar gab es dafür kaum sichere Orte. Als Teenager musste ich, um die Stadt zu verlassen, jedes Mal meinen Vater um Erlaubnis bitten, die er mir meist verweigerte. Also ging ich ohne Wissen meiner Familie.
Heute, als ich sie nicht erreichen konnte, erinnerte ich mich an einen jener Tage. Wir hatten schulfrei und ich traf mich mit meinen Klassenkameraden vor der Schule, um mit ihnen zu einem Ausflugsort außerhalb der Stadt zu ziehen. Auf dem Nachhauseweg fiel mir auf, dass mich seit Stunden niemand angerufen hatte. Ich blickte auf mein Mobiltelefon und sah, dass die Batterie leer war.
Als ich um acht Uhr abends zuhause ankam, stand meine ganze Familie vor dem Haus. Ich bekam es mit der Angst zu tun - etwas Schreckliches musste passiert sein. Mein Vater fragte mich wütend, wo ich gewesen sei. „Mit Freunden unterwegs“, antwortete ich. Er sagte: „Ich habe die ganze Stadt, alle Krankenhäuser und Polizeiwachen nach dir abgesucht.“
Sie dachten, mir wäre etwas zugestoßen. Wenn man in Afghanistan ausgeht, ruft einen die Familie ständig an, bis man wieder zu Hause ist. Wenn man nicht ans Telefon geht, beginnt sie, in Krankenhäusern und auf Polizeiwachen nachzuforschen. Geht man abends aus, bleibt die Mutter auf, bis man zurückkehrt.
Daran musste ich denken, bis ich meine Familie endlich erreichte.
Wenn ich heute mit meiner Familie telefoniere, höre ich jedes Mal Schüsse im Hintergrund. Die Kämpfe sind auf ihrem Höhepunkt, ständig schlagen Raketen und Kugeln in der Umgebung ein. Jeden Tag werden Häuser in der Nachbarschaft aufgegeben, jeden Tag fliehen Menschen. Doch viele, wie meine Familie, können nicht fliehen. Ihr Haus würde ausgeraubt oder zerstört, wie das im Krieg nun einmal der Fall ist. Doch sie können auch nicht bleiben. Nicht, ohne ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Meine Familie befindet sich in derselben Situation wie viele afghanische Zivilisten. Als ältestes Kind meiner Eltern mache ich mir oft Vorwürfe, weil ich sie nicht beschützen kann. Wann immer ich mit ihnen spreche, bitten sie mich um Rat in einer Sache, die sie nicht selbst entscheiden wollen. Jedes Mal muss ich eingestehen, dass ich es auch nicht besser weiß.
Ich kann ihnen nur sagen, dass bald alles gut wird, und sie antworten mit denselben Worten. Es sind dieselben klischeehaften Worte, die mein Großvater meinem Vater vorsagte. Nun tauschen wir sie aus - und nichts hat sich geändert.
— Juli 2021