Publikationen
Vision und Strategie
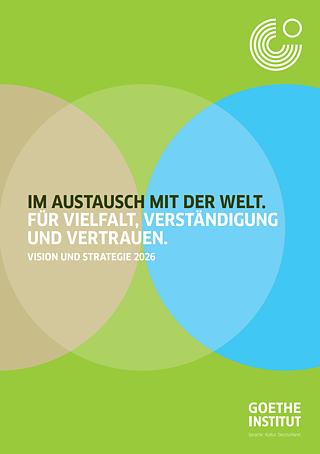
Studien zum Thema Kultur
-
 Das Metaversum verändert Bildungsstrategien und ermöglicht neue Formen künstlerischen Schaffens. Diese Studie basiert auf 41 qualitativen Tiefeninterviews mit Expert*innen aus dem Kreativ- und Kultursektor sowie dem Hochschulbereich. Sie beleuchtet, wie technologische Fortschritte in Kunst, Kultur und Bildung wahrgenommen und umgesetzt werden.
Das Metaversum verändert Bildungsstrategien und ermöglicht neue Formen künstlerischen Schaffens. Diese Studie basiert auf 41 qualitativen Tiefeninterviews mit Expert*innen aus dem Kreativ- und Kultursektor sowie dem Hochschulbereich. Sie beleuchtet, wie technologische Fortschritte in Kunst, Kultur und Bildung wahrgenommen und umgesetzt werden.
Die Studie ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. -
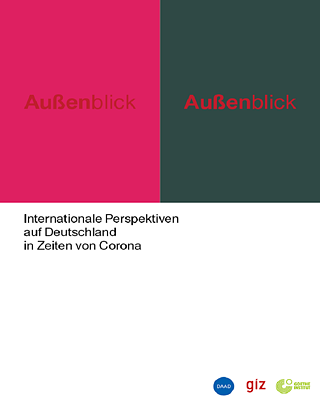 Wie wird Deutschland in der Welt gesehen? Mit der Studie „Außenblick – Internationale Perspektiven auf Deutschland in Zeiten von Corona“ wollen DAAD, GIZ und Goethe-Institut sich gemeinsam dieser Frage nähern. Aus der Perspektive von Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Corona-Pandemie, die alle Bereiche betrifft.
Wie wird Deutschland in der Welt gesehen? Mit der Studie „Außenblick – Internationale Perspektiven auf Deutschland in Zeiten von Corona“ wollen DAAD, GIZ und Goethe-Institut sich gemeinsam dieser Frage nähern. Aus der Perspektive von Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Corona-Pandemie, die alle Bereiche betrifft.
Mehr zur Studie auf unserer Projektseite. -
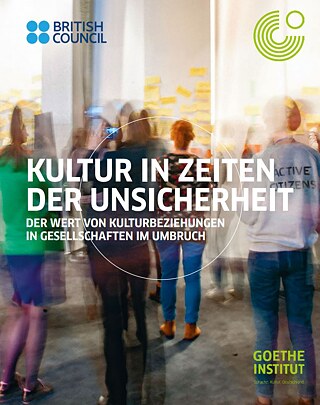 Was ist der Wert von Kulturbeziehungen? Können sie zur Stärkung von Gesellschaften im Umbruch beitragen? Eine neue Studie mit dem British Council zur Wirkung von Kulturbeziehungen in Gesellschaften im Umbruch beschäftigte sich mit diesen Fragen.
Was ist der Wert von Kulturbeziehungen? Können sie zur Stärkung von Gesellschaften im Umbruch beitragen? Eine neue Studie mit dem British Council zur Wirkung von Kulturbeziehungen in Gesellschaften im Umbruch beschäftigte sich mit diesen Fragen. -
 Kann und soll man Wirkungen von Kunst und Kultur bewerten? Das Goethe-Institut beschäftigt sich mit dieser Frage seit mehreren Jahren unter wissenschaftlicher Begleitung. Daraus ist diese Themenbroschüre entstanden.
Kann und soll man Wirkungen von Kunst und Kultur bewerten? Das Goethe-Institut beschäftigt sich mit dieser Frage seit mehreren Jahren unter wissenschaftlicher Begleitung. Daraus ist diese Themenbroschüre entstanden.
Studien zum Thema Sprache
-
 Welche Rolle spielen Deutschkenntnisse für die berufliche und gesellschaftliche Integration von ausländischen Fachkräften? Gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen dem Erlernen der deutschen Sprache und einem erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt? Um diese Fragen zu beantworten, beauftragte das Goethe-Institut eine Kurzanalyse zur Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse unter Einbindung von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Spracherwerb, Integration und Arbeitsmarktpolitik.
Welche Rolle spielen Deutschkenntnisse für die berufliche und gesellschaftliche Integration von ausländischen Fachkräften? Gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen dem Erlernen der deutschen Sprache und einem erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt? Um diese Fragen zu beantworten, beauftragte das Goethe-Institut eine Kurzanalyse zur Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse unter Einbindung von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Spracherwerb, Integration und Arbeitsmarktpolitik. -
 Was treibt Menschen an, die sich vorstellen können, in Deutschland zu leben und zu arbeiten? Was motiviert Fachkräfte dazu, nach Deutschland zu migrieren – und was hält sie davon ab? Welche Unterstützung benötigen sie? Um diese Fragen zu beantworten, führte das Goethe-Institut zusammen mit dem Marktforschungsinstitut GfK eine Umfrage mit über 3.000 Fachkräften in fünf Ländern durch.
Was treibt Menschen an, die sich vorstellen können, in Deutschland zu leben und zu arbeiten? Was motiviert Fachkräfte dazu, nach Deutschland zu migrieren – und was hält sie davon ab? Welche Unterstützung benötigen sie? Um diese Fragen zu beantworten, führte das Goethe-Institut zusammen mit dem Marktforschungsinstitut GfK eine Umfrage mit über 3.000 Fachkräften in fünf Ländern durch. -
 Fachkräfteeinwanderung: Nicht nur der Bedarf an Vorintegration ist gegenwärtig so groß wie nie zuvor, sondern auch deren Nutzen für die spätere Integration in Deutschland. Eine neue Studie des Goethe-Instituts analysiert Vorintegrationsangebote für Erwerbsmigrant*innen und gibt konkrete Handlungsempfehlungen.
Fachkräfteeinwanderung: Nicht nur der Bedarf an Vorintegration ist gegenwärtig so groß wie nie zuvor, sondern auch deren Nutzen für die spätere Integration in Deutschland. Eine neue Studie des Goethe-Instituts analysiert Vorintegrationsangebote für Erwerbsmigrant*innen und gibt konkrete Handlungsempfehlungen. -
 Wie erwerben ausländische Studierende die nötigen Sprachkenntnisse für ihr Studium in Deutschland? Diese Frage steht im Zentrum einer Studie des Goethe-Instituts und der CHE Consult. Aus den Ergebnissen lassen sich Empfehlungen ableiten, wie das steigende Interesse für Deutsch weiter gestärkt werden kann.
Wie erwerben ausländische Studierende die nötigen Sprachkenntnisse für ihr Studium in Deutschland? Diese Frage steht im Zentrum einer Studie des Goethe-Instituts und der CHE Consult. Aus den Ergebnissen lassen sich Empfehlungen ableiten, wie das steigende Interesse für Deutsch weiter gestärkt werden kann. -
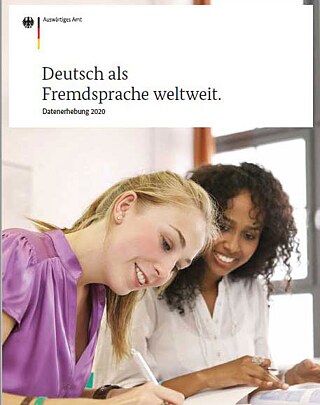 Das Interesse an der deutschen Sprache bleibt weiterhin ungebrochen: Wie die Erhebung „Deutsch als Fremdsprache weltweit“ zeigt, lernen weltweit mehr als 15,4 Millionen Menschen Deutsch.
Das Interesse an der deutschen Sprache bleibt weiterhin ungebrochen: Wie die Erhebung „Deutsch als Fremdsprache weltweit“ zeigt, lernen weltweit mehr als 15,4 Millionen Menschen Deutsch.
Mehr zur Datenerhebung.

