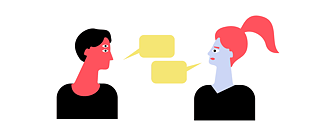Was ist gegen eine leichtfüßige Plauderei einzuwenden? Nichts, sagt Christiane Rösinger. Sie findet: Guter Small Talk unterhält und inspiriert. Ein Plädoyer für die Überwindung der Sprechunlust.
Die alte, bewährte Kulturtechnik des Small Talks scheint in der Krise zu sein. Immer mehr, vor allem junge Menschen, lehnen die laut Duden „leichte, beiläufige Konversation“ als oberflächliches Geplänkel, als sinnentleert und anstrengend ab. In den sozialen Medien wird über die Zumutungen des Small-Talk-Gebots geklagt: „Ich hasse Small Talk!“. Dabei kann doch ein gut geführter Small Talk unterhaltsam, inspirierend und funkelnd sein! Aber anscheinend verliert sich die soziale Fähigkeit zur leichten Plauderei immer mehr.Geteiltes Brot, geteilte Sprache
Das liegt wahrscheinlich auch an der wachsenden Zahl von Menschen, die Schwierigkeiten mit sozialen Interaktionen haben. Neurodivergente Eigenschaften und Diagnosen wie Autismus, ADHS oder soziale Angst können einen kleinen Austausch in freundlicher Atmosphäre mit Fremden oder flüchtig Bekannten zur großen Herausforderung machen. Zudem gibt es eine breite Diskussion über die fehlende Authentizität im Small Talk. Laut Instagram bevorzugen Small-Talk-Fremdelnde tiefere, bedeutungsvollere Gespräche – den „Deep Talk“.Dabei hat doch der Anthropologe Bronisław Malinowski bereits 1923 Small Talk als „phatische Kommunikation“ verstanden – als hochfunktionale, sprachlich vergemeinschaftende Praxis. Als „eine Kommunion, die nicht durch das Teilen von Brot, sondern gleichsam durch das Teilen von Sprache hergestellt wird“. Die Inhalte sind dabei zweckfrei und unter dem Aspekt der Bedeutung irrelevant, wie etwa formelhafte Grüße, Fragen nach dem gesundheitlichen Befinden, Bemerkungen über das Offensichtliche wie das aktuelle Wetter.
Typisch deutsch?
Vielleicht ist die Unfähigkeit zum Small Talk ein deutsches Problem? Nicht repräsentative Umfragen zu kulturellen Unterschieden im Gesprächsverhalten unter zufällig ausgewählten weitgereisten Befragten ergaben Folgendes:Die Deutschen gelten im Gegensatz zu den meisterhaft smalltalkenden Engländern als etwas schwerfällig, weil zu ernsthaft und sachlich in der Themensetzung. Bei den Franzosen geht es angeblich darum, sich im kurzen Gespräch möglichst geistreich und belesen zu geben, während Amerikaner Small Talk gerne nutzten, um ihre grundlose Begeisterung zu verbreiten.
Auch im asiatischen Raum werde Small Talk als wichtige Kulturtechnik angesehen, dabei gelte dort, wie überall sonst, die Regel: Essen, Fußball, Sport und Wetter ja; Krankheiten, Politik, Sorgen, Religion nein. Die Gesprächsverweigerung bei geselligen Zusammenkünften oder zufälligen Begegnungen gilt global als unhöflich. Deshalb ist auch das Internet voll mit Tipps und Tricks zur Überwindung der Small-Talk-Phobie. Dutzende Ratgeberbücher bieten den Introvertierten und Schüchternen Hilfe an.
Gesprächsbereite unter Druck
Bei dem sorgenden, unterstützenden Blick auf Menschen, die Schwierigkeiten mit Small-Talk haben, wird aber eine andere Gruppe vergessen: Die Gruppe der mäßig Extrovertierten, die über keine Diagnose verfügen und im Alltag immer mehr Small Talk und Konversationsarbeit für die Small-Talk-Verweigerer mitmachen müssen.Da sich immer mehr Menschen auf ihre neurodivergenten Eigenschaften berufen und in einer Gruppensituation einfach verstummen, erhöht sich der Druck auf die Gesprächsbereiten.
Gebot der Höflichkeit
Aber auch für Small-Talk-Erprobte können soziale Situationen anstrengend sein. Manchmal würden wir auch lieber schweigen und unsere Ruhe haben, aber das wäre eben sehr unhöflich. Deshalb reißen wir uns zusammen und sagen ein paar Worte. Denn das Gegenüber mit seinem begonnenen Small Talk auflaufen zu lassen, also einfach nicht zu antworten, würde sich für uns viel schlimmer anfühlen, als die Sprechunlust zu überwinden und uns auf ein paar unverbindliche Beobachtungen zu besinnen.Sprechstunde – die Sprachkolumne
In unserer Kolumne „Sprechstunde“ widmen wir uns alle zwei Wochen der Sprache – als kulturelles und gesellschaftliches Phänomen. Wie entwickelt sich Sprache, welche Haltung haben Autor*innen zu „ihrer“ Sprache, wie prägt Sprache eine Gesellschaft? – Wechselnde Kolumnist*innen, Menschen mit beruflichem oder anderweitigem Bezug zur Sprache, verfolgen jeweils für sechs aufeinanderfolgende Ausgaben ihr persönliches Thema.
Januar 2025