Wenn man sein Zuhause oder familiäres Umfeld verlässt – frei- oder unfreiwillig, durch Migration oder Vertreibung – ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich in seiner neuen Umgebung fremd fühlt. Menschen migrieren aus verschiedensten Gründen und erleben auch das Gefühl der Fremdheit auf unterschiedliche Weise, denn es ist eine sehr individuelle Empfindung.
Zum Beispiel könnte es der Ort an sich sein, der ihnen fremd anmutet, oder die Sprache, die sie nun umgibt. Fremd kann man sich nicht nur fühlen, wenn man im Ausland, in der Fremde ist, sondern sogar im Heimatland oder in der eigenen Familie, wenn man sich von dem, was einst vertraut war, entfremdet.Schmerzliche oder traumatische Erlebnisse – verursacht durch Menschenhand oder Naturkatastrophen – tragen meist zur Intensivierung dieser Erfahrungen bei.
Prozesse der Sozialisierung und Enkulturation machen uns alle zu Produkten der spezifischen Lokalität und Kultur, in die wir hineingeboren wurden. Dies ist die Welt, an die wir uns gewöhnt haben, in der wir uns sicher und geborgen fühlen. Hier sind wir selbstbewusst, denn wir kennen sie und sie kennt uns. Wir haben das Gefühl, dazuzugehören. Das Gegenteil ist der Fall an Orten, die wir nicht kennen und uns verunsichern und beängstigen können. Diese Unterscheidung zwischen Vertrautheit und Nichtvertrautheit, zwischen Heimat und Fremde, formt unsere Gedanken, unseren Geist und Lebensstil. Weil Menschen Heim- und Gewohnheitstiere sind, ziehen sie eine Grenze zwischen familiärer und nichtfamiliärer Welt. Daher versuchen sie alles, was sich fremd und ungewohnt anfühlt, zu familiarisieren und anzupassen, bis sie sich heimisch fühlen.
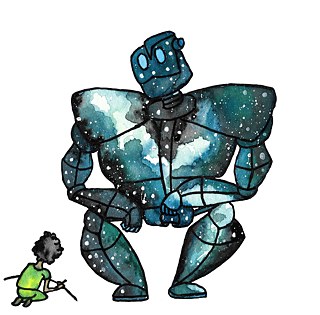
„Die Sprache ist das Haus des Seins.“
In der Tat wurden wir alle in eine bestimmte Kultur, Gesellschaft, Familie und Sprache hineingeboren. Und es ist unsere Muttersprache, durch die wir Kultur, Überzeugungen, Ideen und zahllose andere Dinge vermittelt bekommen und durch die wir sie kommunizieren. Wir leben und wachsen in dieser Sprache; sie prägt maßgeblich unser Denken, unser gesamtes Leben. Da unsere Muttersprache in Beziehung zu unserem Sein, unserer Existenz an sich steht, hat sie eine gewisse ontologische Dimension. Wie Heidegger schrieb, „Die Sprache ist das Haus des Seins.“ Aber könnten wir sagen, dass dies besonders auf unsere Muttersprache zutrifft?
Die Zweitsprache kann nicht auf dieselbe Weise unser Haus des Seins sein, wie es die Muttersprache ist. Die ontologische Dimension existiert lediglich in unserer Muttersprache. Weil wir in sie geboren wurden, mit ihr gelebt haben, damit aufgewachsen sind, ist unser gesamtes Leben von ihr geprägt. Wenn Wissen Macht ist, wie Francis Bacon einst sagte, dann wurden wir in unserer Muttersprache mit Wissen bewaffnet und in dieser am mächtigsten.
Ich wurde in eine kurdische Familie hineingeboren. Als Kurden haben wir keinen eigenen unabhängigen Staat und müssen stattdessen irakische, türkische oder syrische Ausweise tragen. Wir sind Flüchtlinge in unseren Heimatländern. Mit Ausnahme des Irak, wo Kurdisch 2003 nach dem Sturz von Saddam Husseins Regime, eine offizielle Amtssprache wurde, ist die Sprache in den meisten Ländern, in denen wir leben, nicht nur keine offizielle, sondern auch verboten. Uns bleibt keine andere Wahl als eine Fremdsprache zu lernen, in der wir uns dann oft fremd fühlen.
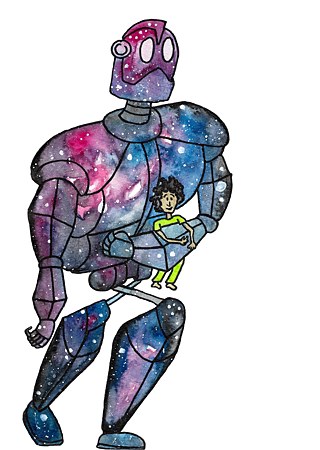
Anfalisierung
Meine erste Konfrontation mit einer Zweitsprache hatte ich mit der arabischen Sprache, da wir im Irak Arabisch lernen mussten. Mein Vater war „anfalisiert“ worden, ermordet in der Anfal-Operation von 1988 (anfal, zu Deutsch „Beute“), dem vom Baath-Regime begangenen Völkermord an den Kurden, um die sogenannte „kurdische Frage“ im Irak ein für alle Mal zu lösen. Ich habe ihn nie kennengelernt, da ich erst drei Monate alt war, als er „anfalisiert“ wurde. Als ich das Wort anfal zum ersten Mal hörte, klang es merkwürdig und fremd für mich. Ich verstand das Wort nicht, denn es war ein arabisch-islamisches Wort aus dem Koran. Ich realisierte jedoch bald, dass es irgendwie im Zusammenhang mit der Abwesenheit und dem Tod meines Vaters stand. Schließlich wurde anfal für mich zum Synonym für Vaterlosigkeit. Als nächstes hörte ich das Wort im Islamunterricht, wo wir beim Auswendiglernen der koranischen Verse zwar Form, nicht aber Inhalt der Wörter beigebracht bekamen. Das Wort anfal verfolgt mich bis heute. Es beeinflusst, wie ich die arabische Sprache wahrnehme und trägt zu meinem Gefühl der Fremdheit bzw. Befremdung in dieser Sprache bei.
Meine Erfahrung mit dem Englischen ist völlig anders, da ich es freiwillig gelernt habe. Ich hatte ein konkretes Ziel, nämlich in einem englischsprachigen Land zu studieren, und dafür brauchte ich die Sprache. Als ich nach England kam, um dort einen Master in Philosophie zu absolvieren, war alles neu für mich. Es fühlte sich an, als wäre meine vertraute Welt zerstört; über Nacht auf den Kopf gestellt worden. Ich sah mich mit radikalen Veränderungen um mich herum konfrontiert, in Sachen Kultur, Glauben und Überzeugungen, sowie in meinem eigenen Selbst und meiner Sprachexistenz. Ich fühlte mich fremd im Englischen, weil ich die Sprache noch nicht gut sprach und mich nicht ausdrücken konnte. Ich musste mich erst mit dieser neuen linguistischen Welt vertraut machen.
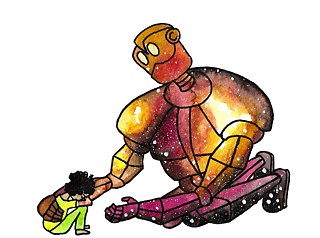
Eine Reflektion der neuen Welt
Meine Drittsprache Englisch war eine Reflektion der neuen Welt, um mich herum und gleichzeitig der Fremdheit, die ich verspürte, da alles anders aussah und sich fremd anfühlte. Mein altes Ich stand auf dem Spiel und mein neues war noch nicht angekommen. Ich musste mich von Grund auf und auf Kosten meines alten Selbst neu aufbauen. Ich hatte das alte Ich zur Seite zu schieben und mein neues Ich ausfindig zu machen. Mein neues Selbst steckte noch in den Babyschuhen; ich war ein „Work in Progress“, wie man hier in England sagt. In meinem Inneren stießen mein altes Ich samt Muttersprache mit meinem neuen Ich und der Drittsprache in einer heftigen Konfrontation aufeinander. Einerseits war diese Reise, mein neues Ich durch die Drittsprache zu ergründen, eine aufregende; wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Aber andererseits krallte sich mein altes Ich an seine Muttersprache. Ich hing über dem Abgrund zwischen beiden Ichs.

Wenn du in einer komplett neuen Welt wie dieser ankommst, bist du erst einmal nur körperlich am neuen Ort, aber dein Geist ist noch nicht da. Du lebst und wohnst noch in deiner eigenen Muttersprache, du denkst noch in deiner eigenen Sprache. Zu tief sind deine Gedanken und Erinnerungen in deiner Muttersprache verwurzelt. Wenn du mit deiner neuen Welt kommunizieren willst, musst du das in ihrer Sprache tun. Aber das kann ein verzwickter Prozess sein, denn zunächst wirst du das Gefühl haben, deine Gedanken in der Muttersprache denken zu müssen, ehe du sie in Übersetzung aussprichst. Wenn du deine Gefühle, deine Ideen und, in der Tat, dich selbst nicht leicht ausdrücken kannst, kommt es unweigerlich zu Problemen. Dann fühlst du dich fremd und als ob deine ganze Identität und Persönlichkeit auf dem Spiel stünden. Du fühlst dich schwach und verletzlich, denn die Waffe der Sprache steht dir noch nicht zur Verfügung, um dich zu verteidigen. Begrenzte Sprachkenntnisse bedeuten begrenzte Macht. Nach einer gefühlt unendlich langen Konfrontation mit der anderen Sprache passiert es endlich und du meisterst sie. All die Zeit, die du in Sprachkurse und peinliche, unbeholfene Unterhaltungen mit Einheimischen investiert hast, zahlt sich endlich aus. Daher hat das Fremdsprachenlernen eine epistemologische Dimension.
Eine zweite oder dritte Sprache wird nie deine erste ersetzen können, die für dich natürlich und ontologisch ist. Du kannst dich in deiner Muttersprache in einer Weise ausdrücken, wie es dir in der Fremdsprache nie möglich sein wird. Vielleicht hast du in deiner Muttersprache ein paar Gedichte auswendig gelernt, Redewendungen, Sprichwörter, Witze, Geschichten, Märchen und Flüche, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass du diesen Zustand in einer anderen Sprache replizieren kannst. In einem Interview mit dem deutschen Journalisten Günter Gaus sprach Hannah Arendt über ihre Muttersprache als Konstante in ihrem Leben, von der Flucht aus Nazi-Deutschland nach Frankreich, von Frankreich in die USA bis zu ihrer Rückkehr nach Deutschland nach dem Krieg:
„Was ist geblieben? Geblieben ist die Sprache. […] Und ich habe immer bewusst abgelehnt, die Muttersprache zu verlieren. Ich habe immer eine gewisse Distanz behalten, sowohl zum Französischen, das ich damals sehr gut sprach, wie zum Englischen, das ich ja heute schreibe. […] Sehen Sie, es ist ein ungeheurer Unterschied zwischen Muttersprache und allen anderen Sprachen. Bei mir kann ich das furchtbar einfach sagen. Im Deutschen kenne ich einen ziemlich großen Teil deutscher Gedichte auswendig. […] Das ist natürlich nie wieder zu erreichen.”
Eine zweite Sprache zu sprechen wird sich nie ganz so anfühlen, wie die eigene Muttersprache. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie es nicht wert ist, gelernt zu werden. Schließlich könnte es sein, dass du in diesem Prozess ein neues Ich entdeckst.
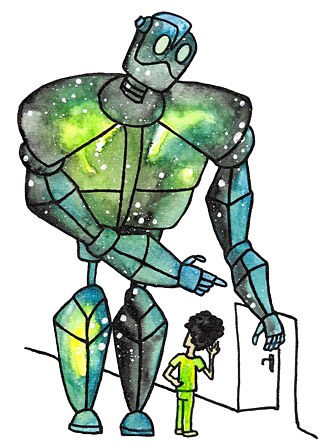
September 2018
