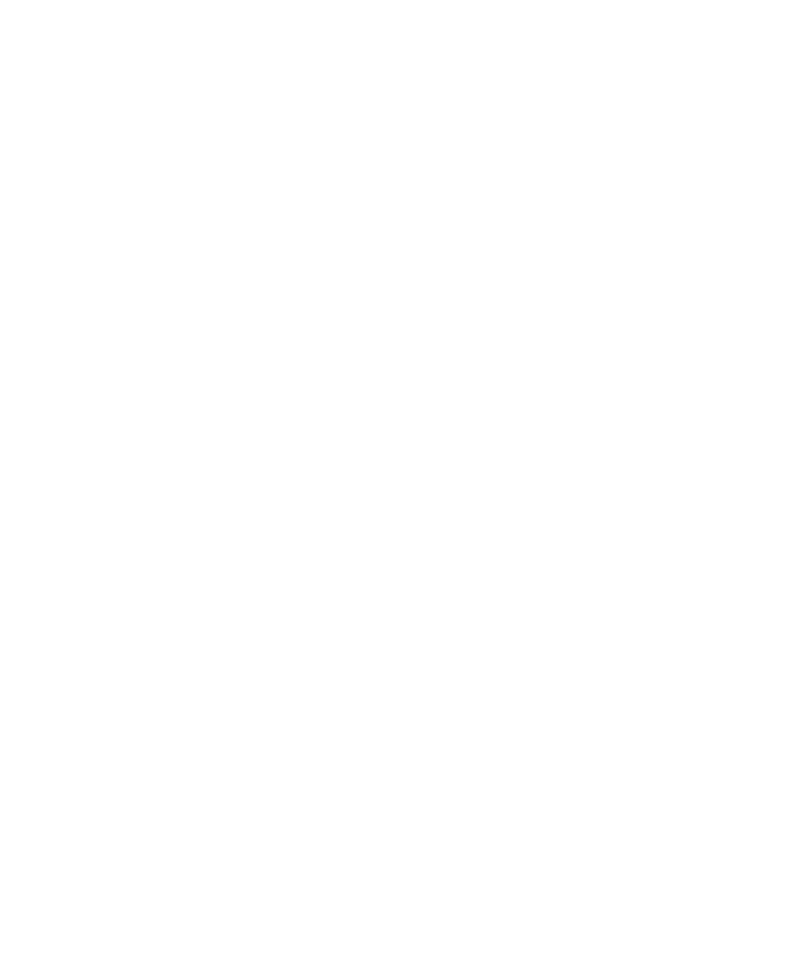Kunst
So schnell geht die Kunst nicht unter: Kunstfreiheit unter politischem Druck
Die Freiheit von Kunst und Kultur ist in Deutschland längst nicht mehr so selbstverständlich, wie wir lange dachten. JÁDU-Autorin Norma Schneider plädiert an Künstler*innen, auch unter dem Eindruck des Rechtsrucks nicht den Kopf in den Sand zu stecken – und sich von denjenigen in unserer europäischen Nachbarschaft inspirieren zu lassen, die Erfahrung mit Repressionen haben.
Mit den politischen Verhältnissen ändern sich auch die Spielräume für die Kunst, das Maß an Freiheit, das sie hat.
Als Ende 2022 in Russland die Verbreitung queerer Inhalte vollständig verboten wurde, war es leicht, das als nur eine weitere von vielen absurden Anwandlungen des Terrorstaats abzutun, als etwas, das weit weg von uns geschieht. Auch bei den Angriffen auf Drag-Shows für Kinder in den USA und den Verboten von Jugendbüchern, die Konservativen zu queer oder zu freizügig erscheinen, neigt man dazu, mit demselben hilflos-besorgten Kopfschütteln zu reagieren wie bei der Wahl Donald Trumps: erschreckend, furchtbar, aber zum Glück jenseits des Atlantiks.
Angriffe auf die Kultur kommen immer näher
Doch man braucht gar nicht so weit zu schauen: Mitten in der EU sind ähnliche Angriffe auf die Freiheit von Kunst und Kultur zu beobachten, und das nicht erst seit gestern. In Ungarn ist es seit 2021 verboten, queere Inhalte Personen unter 18 Jahren zugänglich zu machen, in der Slowakei gibt es gerade einen beispiellosen Angriff auf die Kultur: Die zuständige Ministerin Martina Šimkovičová vertritt die Meinung, LGBTQ-Personen seien „Schuld am Aussterben der weißen Rasse“, entsprechend gestaltet sie ihre nationalistische Kulturpolitik. Leitungen von Kulturinstitutionen wurden ausgetauscht und die Förderung bestimmter Institutionen, deren Programm nicht den Vorstellungen der populistischen Regierung entspricht, wurde ausgesetzt.Auch ein solches Szenario scheint, so beruhigt man sich gerne, für Deutschland weit entfernt zu sein, da es mit der AfD zwar eine Partei gibt, die keinen Hehl daraus macht, dass sie aktiv in die Kulturförderung eingreifen und „ideologische Themen wie ‚Gender‘, ‚Klimaschutz‘ oder die ‚Vielfalt‘“ nicht unterstützen will (so heißt es im Parteiprogramm zur Bundestagswahl in Bezug auf Filmförderung). AfD-Kulturpolitiker Hans-Thomas Tillschneider fordert, die Vergabe von Geldern an ein „selbstbewusstes Bekenntnis zur deutschen Identität“ zu binden. Doch eine Regierungsbeteiligung der AfD in der nahen Zukunft will man sich noch nicht vorstellen. In manchen Regionen ist die Partei allerdings bereits jetzt so stark, dass sie Einfluss auf Entscheidungen über kommunale Kultur hat. Und auch ohne Mehrheit im Parlament ist die Gefahr von rechts sehr real: In Shitstorms hetzen Rechtsradikale gegen Veranstaltungen, bauen Druck auf, schüchtern ein. Oft haben sie dabei queere Themen oder Projekte mit Geflüchteten im Fokus. Der Theaterkritiker Peter Laudenbach berichtet in seinem Buch Volkstheater. Der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit von zahlreichen rechten Angriffen auf Kulturinstitutionen und Künstler*innen in den letzten Jahren.
Wenn öffentliche Gelder wegfallen und die Abhängigkeit von Eintrittsgeldern oder privaten Spender*innen größer wird, wächst die Gefahr, dass es bestimmte Dinge einfach nicht mehr geben wird, dass bestimmte Perspektiven weniger sichtbar werden.
Dabei ist es gerade die Kultur jenseits der großen Museen, Theater und Konzerthäuser, die eine wichtige Rolle für marginalisierte Menschen spielt. Kleine kulturelle Projekte, nichtkommerzielle Räume, in denen sich Ausstellungen, Performances und Konzerte auf die Beine stellen lassen, bieten für queere oder von Rassismus betroffene Menschen Schutzräume und Möglichkeiten, sich auszudrücken, die sie auf den großen Bühnen nicht haben. Wenn öffentliche Gelder wegfallen und die Abhängigkeit von Eintrittsgeldern oder privaten Spender*innen größer wird, wächst die Gefahr, dass es bestimmte Dinge einfach nicht mehr geben wird, dass bestimmte Perspektiven weniger sichtbar werden.
Lernen von denjenigen, die Repressionen trotzen
Doch wenn wir eines lernen können von den Künstler*innen in Ländern, in denen politische Kunst nicht gefördert, sondern bestraft wird, dann ist es das: nicht aufzugeben und die Freiräume und die Unterstützung, die wir haben, zu verteidigen. Ja, auch in Deutschland müssen sich Künstler*innen auf mehr Gegenwind einstellen. Aber es ist noch verdammt viel möglich und es gibt keinen Grund, die Hoffnung zu verlieren. Wir haben es in der Hand, zu verhindern, dass es in Deutschland so schlimm wird, wie es in vielen anderen Ländern bereits ist. Wir können und müssen uns wehren gegen das Erstarken der Rechten, dürfen es nicht hinnehmen, wenn Künstler*innen angegriffen werden, müssen zusammenhalten und uns schützend vor sie stellen. Und auch wenn es trotzdem schlimmer wird, die AfD mehr Macht erhält – und wie schnell so etwas gehen kann, sieht man dieser Tage in Österreich –, dürfen wir trotzdem nicht aufgeben. Sondern müssen vorbereitet sein. Je unfreier die politischen Verhältnisse werden, desto wichtiger ist es, weiterzumachen, desto mehr Bedeutung kommt unabhängiger Kunst zu: Sie hat vielleicht keinen großen Einflussfaktor in der Öffentlichkeit, aber sie kann Schutz und Gemeinschaft sein für die, die aufgrund ihrer Meinung oder ihrer Identität der Mehrheitsgesellschaft entgegenstehen, die diskriminiert oder verfolgt werden. Und eine kleine Chance, Menschen aufzurütteln und zum Nach- oder gar Umdenken zu bewegen, gibt es immer.Wir sollten uns vernetzen und austauschen mit denjenigen, die schon Erfahrung darin haben, Kunst unter den widrigsten Umständen zu machen. Die wissen, wie man sich vor Angriffen schützt und trotz dominierender rechter Narrative sein Ding macht, mit welchen Strategien man Sichtbarkeit schaffen kann, ohne sich in zu große Gefahr zu bringen. Auch in Deutschland gibt es dafür Gelegenheit – warum nicht mal eine Ausstellung von Exil-Künstler*innen aus Belarus besuchen und zuhören, wenn sie berichten, was sie erlebt haben und wie es ihren Freund*innen geht, die noch im Land sind? Warum nicht mal queere Performer*innen aus Georgien einladen? Oder bei Kolleg*innen in Ungarn nachfragen, wie die Lage ist? Von ihnen können wir viel lernen und vor allem uns gegenseitig unterstützen. Vielleicht wird es in Zukunft in Deutschland statt den weiten Freiräumen der „Kulturlandschaft“ nur noch Inseln geben, auf denen politische Kunst, queere Kunst möglich ist. Aber eine Insel geht auch bei stürmischer See nicht so schnell unter.
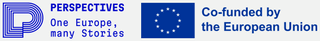
Dieser Artikel erschien zuerst in der deutsch-tschechisch-slowakisch-ukrainischen Zeitschrift Jádu im Rahmen des von der EU kofinanzierten Projekts PERSPECTIVES für unabhängigen, konstruktiven, multiperspektivischen Journalismus. >>> Mehr über PERSPECTIVES