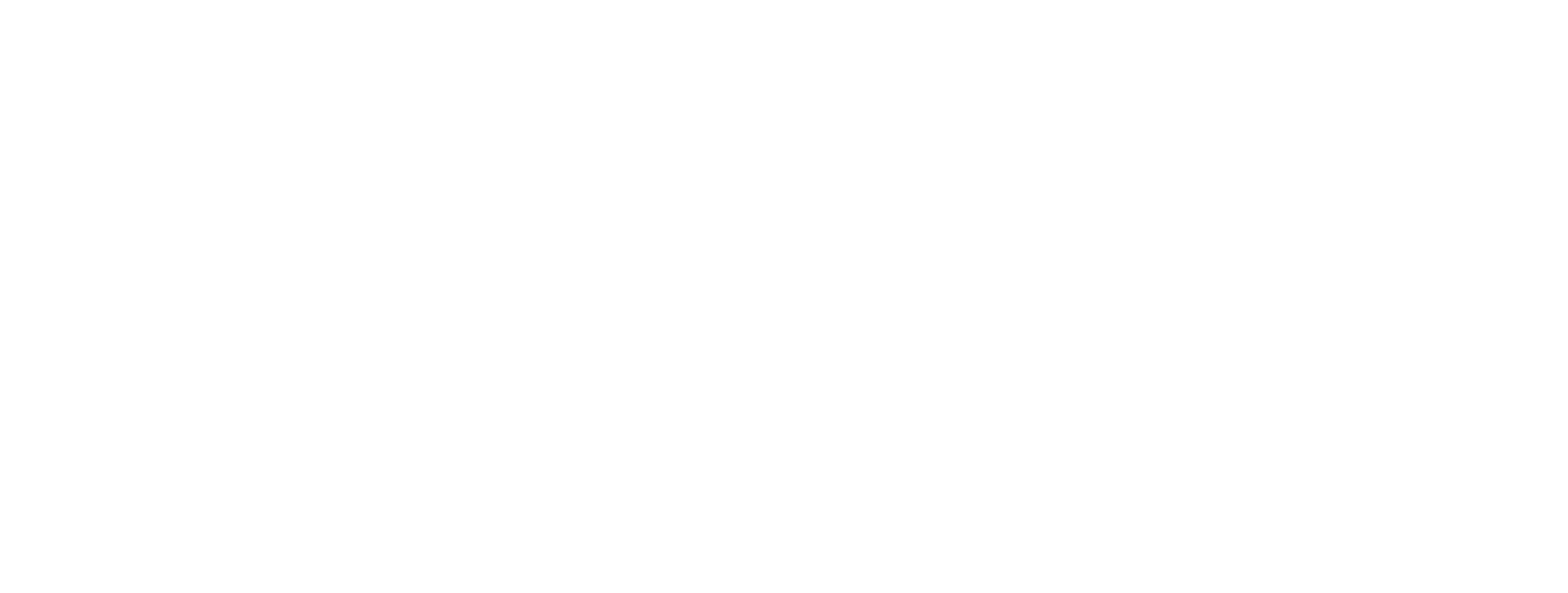Naturgesetze
Fehler heißt Schöpfung
Dank der Naturwissenschaften glauben wir, die Welt sei geordnet, harmonisch, effizient – und fehlerfrei. Jedoch: Kosmos und Natur sind gegenüber Unstimmigkeiten und Ungereimtheiten offen.
Eine Quelle hoch im ligurischen Appenin, der dem Mittelmeer zugewandten Seite des italienischen Gebirgsrückens. Eichen und Esskastanien überschatten aus dem Hang ragende Scheiben von Schiefer. Aus den Spalten zwischen den wenige Zentimeter auseinander gespreizten Felsplatten rinnt es feucht hervor. Das Wasser sammelt sich in einer steinigen Mulde, überragt von Hasel- und Erlenbüschen.
Welke Blätter vom Vorjahr liegen in der flachen Wanne, rundgespülte Bruchstücke des Schiefers, Kiesel aus Granit. Über einen Fels bahnt sich das Nass seinen Weg. Leise sprudelt es über die Kante, macht einen Bogen um einen bemoosten Block, wird von gestürzten Stämmen aufgehalten und umkurvt einen weiteren aus dem Hang ragenden Felsen.
Natürlich macht die Gravitation keine Ausnahme. Wasser fließt immer nach unten. Aber es wird dabei aufgehalten. Der Physiker im Labor muss all diese Störungen, aus denen Umwege und Schleifen folgen, eliminieren, um seine Gleichungen zu formulieren. Will man die Gravitation korrekt messen, muss man einen Vakuumturm bauen. Sonst schleichen sich Fehler ein. Die Wirklichkeit, so scheint es, baut sich gerade darauf auf: auf dem Prinzip, dass die Naturgesetze oft in maximaler Unreinheit auftauchen – und dass gerade diese Abweichungen von der Geradlinigkeit für die Gestalt des Kosmos sorgen.
In unserem Alltagsverständnis vermuten wir oft das Gegenteil. Gelehrte haben uns über Jahrhunderte suggeriert, die Natur sei der Inbegriff der Ordnung, Effizienz und Fehlerfreiheit. Die Natur, ja die Wirklichkeit selbst sei ein Inbild der Harmonie (das wir Menschen durch unsere wurstfingrigen Basteleien beständig stören und zunehmend zerstören). Schaut man aber auf den Kosmos in Aktion, so scheint es vielfach, dass dieser mit den Leerstellen in seinen Regeln spielt, und weniger harmonisch ist als neugierig. Er ist gegenüber Unstimmigkeiten und Ungleichgewichten offen – wie der Mensch.
Wasserstoff hingegen, Nachbar des Heliums im chemischen System, ist ständig dabei, in seine Einzelteile zu dissoziieren. Er verliert sein Elektron, wird zum reaktiven Element in Säuren und zum Partner des Sauerstoffs im Element des Lebens, dem Wasser. Natürlich gelten auch für H2 die Gesetze der Chemie. Doch das Element nutzt deren ganze Bandbreite zum Unruhestiften und wirft jeden Ansatz der Makellosigkeit über den Haufen.
Der Physikochemiker Ilya Prigogine und die Wissenschaftstheoretikerin Isabelle Stengers sehen in der unerwarteten Abschweifung sogar den Schlüssel zur Selbstorganisation des Kosmos. Für sie ist die Natur nicht Ordnung, die dem Chaos trotzt, sondern Ordnung, weil das Chaos ständig seine Finger im Spiel hat. So wie beim berühmten Schmetterlingseffekt: In einem komplexen System kann eine Abweichung dazu führen, dass sich alles anders entwickelt als in der ursprünglichen Stoßrichtung angelegt. So könnte der Luftzug, den der sprichwörtliche Schmetterlingsflügel verursacht, über Rückkopplungen und Selbstverstärkungen einen tropischen Zyklon ins Rollen bringen.
Es ist erstaunlich, wie Lukrez die moderne Physik vorhergesehen hat. Heute wissen wir, dass Atome und Moleküle nur scheinbar stabil sind. Sie ruhen in sich selbst, bis sie sich irgendwann unerwartet zersetzen. Diese Quantenfluktuationen machen Materie zu etwas Fließendem. Am deutlichsten wird das beim radioaktiven Zerfall. Hier gibt die Halbwertszeit an, wann sich die Hälfte einer bestimmten Stoffmenge in ein anderes Element verwandelt hat. Ob ein einzelnes Atom darin am Anfang oder am Ende zerfällt – oder gar nicht –, ist unvorhersagbar. Mit der Quantenphysik ist der Fehler ins Herz der Naturgesetze eingezogen.
Eine fehlerlose Biologie wäre tödlich. Weil sich die Umwelt ständig verändert (durch Abweichungen von der Norm natürlich), würden stets perfekt reproduzierte Tier- und Pflanzenarten unweigerlich ausgelöscht, etwa durch eine sich erwärmende oder abkühlende Erde. Der Fehler ist also notwendig, damit Individualität zu erscheinen vermag. Das könnte eine wichtige Lektion aus der Natur sein: Fehler ermöglichen Schöpfung. Der französische Dichter und Kriegsflieger Antoine de Saint-Exupéry, der 1944 bei einer Mission über dem Atlantik verschollen ist, sagt das in einem seiner Bücher so:
„Ich bin der Fehler in der Rechnung. Ich bin das Leben.“
Welke Blätter vom Vorjahr liegen in der flachen Wanne, rundgespülte Bruchstücke des Schiefers, Kiesel aus Granit. Über einen Fels bahnt sich das Nass seinen Weg. Leise sprudelt es über die Kante, macht einen Bogen um einen bemoosten Block, wird von gestürzten Stämmen aufgehalten und umkurvt einen weiteren aus dem Hang ragenden Felsen.
Überall sind Hindernisse
Das Wasser fließt zu Tal, doch niemals gerade. Stets stellt sich etwas seinem Rinnen in den Weg. Eine Falte in der Landschaft, Totholz, Schieferblöcke, eine sumpfige Wiese. Die Flussrichtung des Quellbachs gehorcht allein der Gravitation. Doch wie er schließlich fließt, beruht auf den Fehlern ihrer Umsetzung. Überall sind Hindernisse. Man könnte sagen: Was wir Landschaft nennen, beruht darauf, dass die Geradlinigkeit nicht funktioniert. Die Gestalt der Welt entspringt ebensosehr dem Naturgesetz wie der Abweichung, die zu immer neuen Interpretationen nötigt.Natürlich macht die Gravitation keine Ausnahme. Wasser fließt immer nach unten. Aber es wird dabei aufgehalten. Der Physiker im Labor muss all diese Störungen, aus denen Umwege und Schleifen folgen, eliminieren, um seine Gleichungen zu formulieren. Will man die Gravitation korrekt messen, muss man einen Vakuumturm bauen. Sonst schleichen sich Fehler ein. Die Wirklichkeit, so scheint es, baut sich gerade darauf auf: auf dem Prinzip, dass die Naturgesetze oft in maximaler Unreinheit auftauchen – und dass gerade diese Abweichungen von der Geradlinigkeit für die Gestalt des Kosmos sorgen.
In unserem Alltagsverständnis vermuten wir oft das Gegenteil. Gelehrte haben uns über Jahrhunderte suggeriert, die Natur sei der Inbegriff der Ordnung, Effizienz und Fehlerfreiheit. Die Natur, ja die Wirklichkeit selbst sei ein Inbild der Harmonie (das wir Menschen durch unsere wurstfingrigen Basteleien beständig stören und zunehmend zerstören). Schaut man aber auf den Kosmos in Aktion, so scheint es vielfach, dass dieser mit den Leerstellen in seinen Regeln spielt, und weniger harmonisch ist als neugierig. Er ist gegenüber Unstimmigkeiten und Ungleichgewichten offen – wie der Mensch.
Ein Element, das die Bandbreite der Naturgesetze zum Unruhestiften nutzt
Denken wir etwa an ein Atom. Bei diesem kreisen Elektronen in verschiedenen Orbitalen um einen Kern. Je makelloser das Atom, desto weniger lässt sich freilich mit ihm anfangen. Das Edelgas Helium etwa, bei dem die Elektronenpositionen ebenmäßig besetzt sind, erscheint aus physikalischer Sicht als vollendet harmonisch. Aber es ist kaum reaktiv. Helium riecht nicht, hat keine Farbe, ist unbrennbar und ungiftig. Der Stoff geht – wie auch die anderen Edelgase (beispielsweise Neon, Argon und Xenon) – keine Bindungen ein, wie ein keuscher Pietist, der sich keinen Fehler leistet und dadurch zu einem Langweiler geworden ist.Wasserstoff hingegen, Nachbar des Heliums im chemischen System, ist ständig dabei, in seine Einzelteile zu dissoziieren. Er verliert sein Elektron, wird zum reaktiven Element in Säuren und zum Partner des Sauerstoffs im Element des Lebens, dem Wasser. Natürlich gelten auch für H2 die Gesetze der Chemie. Doch das Element nutzt deren ganze Bandbreite zum Unruhestiften und wirft jeden Ansatz der Makellosigkeit über den Haufen.
Der Physikochemiker Ilya Prigogine und die Wissenschaftstheoretikerin Isabelle Stengers sehen in der unerwarteten Abschweifung sogar den Schlüssel zur Selbstorganisation des Kosmos. Für sie ist die Natur nicht Ordnung, die dem Chaos trotzt, sondern Ordnung, weil das Chaos ständig seine Finger im Spiel hat. So wie beim berühmten Schmetterlingseffekt: In einem komplexen System kann eine Abweichung dazu führen, dass sich alles anders entwickelt als in der ursprünglichen Stoßrichtung angelegt. So könnte der Luftzug, den der sprichwörtliche Schmetterlingsflügel verursacht, über Rückkopplungen und Selbstverstärkungen einen tropischen Zyklon ins Rollen bringen.
Fehler im Ebenmaß der reinen Materie
Prigogine und Stengers bezogen sich auf einen Schlüsseltext des Abendlandes: Das 1417 wiederentdeckte Lehrgedicht Über die Natur der Dinge des römischen Dichters und Philosophen Lukrez. In diesem beschreibt der Lateiner den Kosmos als reine Materie. Atome ziehen auf geraden Bahnen durch den leeren Raum, einsam und unberührt – wäre da nicht das „Clinamen“. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine winzige, unkalkulierbare, Abweichung von der Geradlinigkeit. Das Clinamen bewirkt für Lukrez, dass sich Fehler ins Ebenmaß der reinen Materie einschleichen. Diese führen zum Zusammenstoß der einzelnen Teilchen, zu Anziehung und Zusammenballung und von da zu den Formen der Welt.Es ist erstaunlich, wie Lukrez die moderne Physik vorhergesehen hat. Heute wissen wir, dass Atome und Moleküle nur scheinbar stabil sind. Sie ruhen in sich selbst, bis sie sich irgendwann unerwartet zersetzen. Diese Quantenfluktuationen machen Materie zu etwas Fließendem. Am deutlichsten wird das beim radioaktiven Zerfall. Hier gibt die Halbwertszeit an, wann sich die Hälfte einer bestimmten Stoffmenge in ein anderes Element verwandelt hat. Ob ein einzelnes Atom darin am Anfang oder am Ende zerfällt – oder gar nicht –, ist unvorhersagbar. Mit der Quantenphysik ist der Fehler ins Herz der Naturgesetze eingezogen.
Eine fehlerlose Biologie wäre tödlich
Noch staunenswerter wird die Idee des Lukrez, wenn man sich die Biologie anschaut. Denn hier bildet die Abweichung die Grundkraft des Lebens. Evolution kann nur stattfinden, wenn eine Mutation – ein Fehler in der Genkopie – zu einem neuen körperlichen Merkmal führt. Oft sind Genfehler für Organismen schon im Embryonalstadium tödlich. Manchmal aber haben Mutationen eine nützliche Eigenschaft zur Folge – längere Flügel, buntere Farben, einen Hang zum Gedichte schreiben –, mit der etwas Neues die „endlosen Formen größter Schönheit“, wie Darwin das Lebensreich nannte, um eine weitere vermehrt.Eine fehlerlose Biologie wäre tödlich. Weil sich die Umwelt ständig verändert (durch Abweichungen von der Norm natürlich), würden stets perfekt reproduzierte Tier- und Pflanzenarten unweigerlich ausgelöscht, etwa durch eine sich erwärmende oder abkühlende Erde. Der Fehler ist also notwendig, damit Individualität zu erscheinen vermag. Das könnte eine wichtige Lektion aus der Natur sein: Fehler ermöglichen Schöpfung. Der französische Dichter und Kriegsflieger Antoine de Saint-Exupéry, der 1944 bei einer Mission über dem Atlantik verschollen ist, sagt das in einem seiner Bücher so:
„Ich bin der Fehler in der Rechnung. Ich bin das Leben.“