Das Zeitalter der Anästhesie
Vergessene Späne in einer Schublade
(Auszug aus dem Roman DAS ZEITALTER DER ANÄSTESIE)
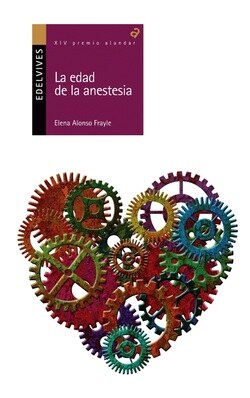
Einmal traten mir auf die dümmste Art und Weise Tränen in die Augen, und das war im Kindergarten für die Kleinsten. Ich ging dorthin in der Hoffnung, Jan zu treffen, aber ich sah ihn nicht. Stattdessen las eine der Betreuerinnen einigen Kindern eine Geschichte vor, die in einem Kreis um sie herum saßen und gebannt zuhörten. Ich ging hinüber, um zuzuhören, und erkannte sofort die Geschichte, die das Mädchen las: "Der selbstsüchtige Riese" von Oscar Wilde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es geht um einen Riesen, ein Scheusal, immer bereit, gute Gefühle zunichte zu machen, der den Kindern verbietet, in seinem Garten zu spielen, wodurch der Frühling nie dorthin kommt. Eines Tages jedoch berührt die Liebe eines Kindes das Herz des Riesen, aber es ist zu spät für die Umkehr. Der Oger stirbt und bedauert all die Zeit, die er verloren hat, bedauert diese selbstsüchtige Existenz, die sein Herz unter dem ewigen Frost des Winters gehalten hat, die dem Frühling nicht erlaubt hat, für ihn zu blühen, die der Schönheit nicht erlaubt hat, in sein Leben zu treten. Ich weiß, ich weiß: Es klingt ziemlich kitschig, wenn man es so erzählt; aber die Wahrheit ist, dass es eine sehr schöne Geschichte ist, oder so scheint es mir, vielleicht weil meine Mutter sie mir oft vorlas, als ich ein kleines Mädchen war.
Als das Ende immer näher rückte, versagte ihre Stimme, und ihre Sätze kamen gebrochen wie ein Hahnenschrei heraus. Sie versuchte vergeblich, ihre Fassung wiederzuerlangen, damit ich nicht merkte, dass sie im Begriff war zu weinen, aber ihre Stimme überschlug sich hoffnungslos, als sie das Ende erreichte, jenen Moment, in dem der Riese, jetzt ein alter Mann, von einer Woge der Freundlichkeit getroffen wurde, gerade als es für alles zu spät war. Damals habe ich mich gefragt, warum meine Mutter in dieser Passage weinte. Warum eigentlich, denn das Gute hatte gesiegt, was der Zweck von Märchen ist, wie ich verwirrt zu ahnen gelernt hatte: Kinder zu lehren, indem man uns glauben macht, dass am Ende immer die Guten gewinnen. Warum also diese Tränen meiner Mutter, dachte ich, wenn am Ende der Riese seine Fehler einsah und das Gute triumphierte. Ich habe es nicht verstanden. Später, als ich kein Kind mehr war, kam es mir eines Tages in den Sinn, diese Geschichte noch einmal zu lesen, und endlich schien ich zu verstehen, woher die Traurigkeit meiner Mutter herrührte. Aber auch für mich war es zu spät: Ich war erwachsen, und das Geheimnis war für immer von der Abtrünnigkeit meiner Kindheit verschluckt worden.
Als ich diese Geschichte im Kindergarten der Klinik wieder hörte und all diese Kinder in Ehrfurcht und Staunen sah, weinte ich wie ein Narr. Ich weiß nicht, warum ich wirklich weinte. Ich weiß nicht, ob ich meine Mutter vermisste, oder Marga, oder sogar meinen Vater, der sein Leben anderswo aufgebaut hatte, schon so weit weg, so fremd meiner Gegenwart und meiner Zukunft. Da war ich und wimmerte wie ein kleines Waisenkind. Ich wischte mir gerade noch die Tränen mit dem Handrücken weg. Vielleicht, so kam es mir in dem Moment in den Sinn, vermisste ich die Zeit, als auch ich ein Kind war, das einer Geschichte gebannt zuhörte, ein Kind, das gewisse Dinge noch nicht wusste, zum Beispiel, dass im Leben nicht immer die Guten gewinnen. Mehr noch: dass es sehr schwierig ist, zu definieren, was "gewinnen" bedeutet. Haben diejenigen von uns gewonnen, die triumphierend aus einer Operation hervorgingen, diejenigen von uns, die aus einem dieser narkotischen Träume zurückkehrten, die die Anästhesie bietet, haben diejenigen verloren, die für immer auf dem Operationstisch blieben? Haben die Babys, die gesund auf die Welt kamen, gewonnen? Haben diejenigen von uns, die von Krankheit gezeichnet geboren wurden, verloren? Was waren die Regeln, die dieses Rennen bestimmten, in dem einige gewannen und andere verloren? Wer hatte diese Regeln geschrieben? Und warum?
Autorin

Mehr...