Sprechstunde – die Sprachkolumne
Sprachlandschaften
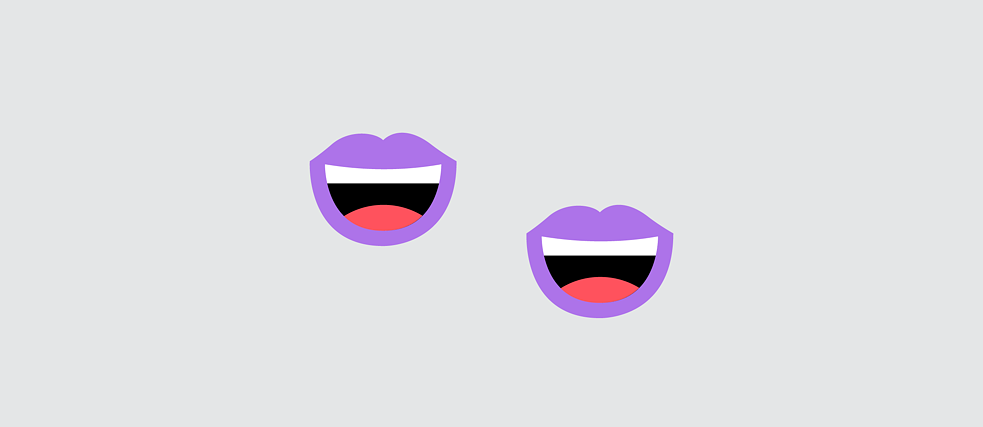
Um die Sprache werden manchmal Kulturkämpfe geführt – aktuell zum Beispiel in der Auseinandersetzung um geschlechtergerechte Sprache. Doch auch Dialekte bergen Streitpotenzial.
Von Olga Grjasnowa
Man könnte meinen, der größte Kampf in der deutschen Kultur würde gerade um die Gendersternchen und das generische Maskulinum geführt werden, also um die Frage, ob man Menschen anderen Geschlechts eigentlich mit meine, wenn man „der Lehrer“, „der Polizist“ oder „der Kanzler“ sagt. Spätestens seit meine Tochter und ihre Freundin glauben, keine Astronautinnen werden zu können, weil es nur Astronauten gibt, bezweifle ich das Konzept des inklusiven generischen Maskulinums.
Doch um Sprache wird seit jeher gerungen. Vor allem um die Deutsche. Deutsch besitzt sehr viele Dialekte, Mundarten und Standardsprachen, die nicht ohne weiteres den Sprecher*innen des „Hochdeutschen“ verständlich sind. Jeder Dialekt verfügt nicht nur über ein eigenes Vokabular, sondern auch über grammatikalische Eigenheiten und unterschiedliche Sprachmelodien – allerdings hat sich diese Vielfalt im Laufe der Jahre immer mehr verloren. Im Gegensatz dazu steht das Hochdeutsch, die standardisierte Sprache, in der wir schreiben, weshalb sie in der Schweiz meines Wissens nach auch als „Schriftdeutsch“ bezeichnet wird. Der Prozess der Standardisierung setzte mit Luthers Bibelübersetzung ein, wurde vom Buchdruck begünstigt und bezog sich zumeist auf die geschriebene Sprache.
Gleiches Gebäck – verschiedene Namen
Ich wurde in Hessen sozialisiert und freue mich immer, wenn ich diesen Dialekt höre – wenn die Menschen anfangen, eine Frage durch „gell“ zu unterstreichen und „ich“ wie „isch“ ausgesprochen wird, ist meine Welt wieder in Ordnung. Frankfurt am Main ist für mich daher eine Stadt, die mir nicht nur von ihrem Stadtbild, ihrem Fluss und den Straßen her vertraut ist, sondern auch eine Stadt, die sich vertraut anhört. In Bayern oder in Köln verstehe ich dagegen oft kaum etwas, wenn Leute Dialekt sprechen. Das Sächsische, das mich während meines Studiums in Leipzig umgab, ist für mich nach wie vor unverständlich. Selbst das Berlinerische ist mir nach einem Jahrzehnt in der Stadt immer noch fremd. Vielleicht liegt es daran, dass hier die „Kreppel“ oder auch „Berliner“ – dieses runde Gebäck, das mit Marmelade gefüllt und mit Puderzucker bestäubt ist – als „Pfannkuchen“ und „Pfannkuchen“ wiederum als „Eierkuchen“ bezeichnet werden. Die „Berliner“ können uns übrigens in anderen Regionen Deutschlands auch noch als „Krapfen“, „Kreppel“ und „Puffel“ begegnen. Sämtliche Bezeichnungen meinen dasselbe, und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich in dieser Sache zu einem gewissen Lokalpatriotismus neige. Berliner sind Berliner, maximal sind sie Kreppel.Lieblingsdialekt
Diese Auseinandersetzung wird übrigens noch erbitterter als die um die gendergerechte Sprache geführt, allerdings nur zwischen Zugezogenen und Alteingesessenen. Ähnlich verhält es sich mit den Wörtern für sprechen: „babbeln“ in Hessen, „schnacken“ in Hamburg oder „schwätzen“ im Südwesten Deutschlands. Noch komplizierter wird es jenseits der geografischen, nicht aber der sprachlichen Grenzen, in Österreich und der Schweiz.Ich beherrsche leider keinen Dialekt, außer ein paar Brocken, aber eigentlich wäre dies eine schöne und bereichernde Herausforderung in Sachen Spracherweiterung. Sollte ich mich dieser jemals stellen, dann würde ich wahrscheinlich, Sie ahnen es vermutlich, zum hessischen und nicht zum Berliner Dialekt tendieren.
Sprechstunde – die Sprachkolumne
In unserer Kolumne „Sprechstunde“ widmen wir uns alle zwei Wochen der Sprache – als kulturelles und gesellschaftliches Phänomen. Wie entwickelt sich Sprache, welche Haltung haben Autor*innen zu „ihrer“ Sprache, wie prägt Sprache eine Gesellschaft? – Wechselnde Kolumnist*innen, Menschen mit beruflichem oder anderweitigem Bezug zur Sprache, verfolgen jeweils für sechs aufeinanderfolgende Ausgaben ihr persönliches Thema.