 © Dominio público
© Dominio público
Ist der Süden der Literatur das Ergebnis einer kolonialistischen Dialektik, die Aufgeklärte und Wilde, Weiße und Schwarze, Zivilisation und Barbarei einander gegenüberstellt?
Dass der Süden „unten“ ist, ist eine willkürliche Festsetzung der Geografie – beim Blick auf die im Weltall kreisende Erdkugel zeigt sich die Relativität der Rede von unten und oben in aller Deutlichkeit. In den Worten Astor Piazzollas: „Süden, riesiger Mond, Himmel auf dem Kopf.“ Trotzdem nährt sich die Vorstellungskraft der Literatur, so wie wir sie kennen, seit jeher von der angeblichen Sinnlichkeit und Barbarei des Südens, von seinen Bananenrepubliken und Operettenkaisern, seinen Diktatoren und Giftpfeilen. Wer einen literarischen Beweis dafür sucht, dass der Süden womöglich bloß ein großes Missverständnis ist, braucht allerdings nur an die klassische Erzählung Die Sonnenfinsternis des guatemaltekischen Schriftstellers Augusto Monterroso zu denken. Sie beginnt damit, dass ein spanischer Mönch mitten im amerikanischen Urwald in höchste Lebensgefahr gerät – das Ganze spielt offenbar in der Frühzeit der Begegnung beider Welten, soll heißen: der Begegnung von Nord und Süd. Kurz bevor er von den Mitgliedern eines Stammes von – wie anzunehmen ist – Wilden geopfert werden soll, erinnert sich der Mönch an Aristoteles und denkt sich mithilfe seines gesamten westlichen Wissens einen Trick aus: Da an diesem Tag, wie er weiß, eine Sonnenfinsternis stattfinden wird, droht er den Eingeborenen, die Sonne „zu verdunkeln“, falls sie versuchen, ihn zu töten. In der nächsten Szene sieht man die Mayas, die das herausgeschnittene Herz des Mönchs in den Händen halten und seelenruhig die Daten sämtlicher künftiger Sonnenfinsternisse aufsagen, die in ihren Codices exakt verzeichnet sind. Ende der Geschichte.
So funktioniert oder funktionierte bis dahin die Vorstellung der Literatur vom Süden: Sie beruhte auf Unkenntnis, hantierte mit Exotismen, war sich der „Überlegenheit“ des Nordens sicher. In einer anderen berühmten Erzählung, diesmal von einem anderen Meister, Jorge Luis Borges, die zudem den Titel Der Süden trägt, durchquert ein Mann, der von Deutschen abstammt, die Stadt Buenos Aires („Wie jedermann weiß, beginnt der Süden jenseits der Avenida Rivadavia“) und dringt anschließend immer tiefer in die Welt der Gauchos und Vorstadtbewohner vor. Bis es schließlich zum Zusammenstoß mit dem Irrationalen kommt, als der Mann, fast ohne erkennbaren Anlass, in einen Streit verwickelt wird. Sinnlose Gewalt, wie sie den Süden immer wieder erschüttert. Der Krieg der Leute von unten. Borges‘ Erzählung mit ihrem Ende, das so weit und offen ist wie die Ebene rings um die argentinische Hauptstadt, führt erneut vor, dass es bei der Begegnung der beiden Kontinente – beziehungsweise ihrer Bewohner – unweigerlich zum Zusammenprall kommen muss, zum Duell von Vernunft und Instinkt.
Von hier aus betrachtet
 © Alianza Editorial
© Alianza Editorial
Im Unterschied zur kolonialistischen Perspektive mit ihrer spezifischen Dialektik hat sich die Literatur der südlichen Erdhälfte nicht „den Süden in den Blick nehmend“, sondern „vom Süden aus blickend“ entwickelt. Von der altverwurzelten mündlichen Erzähltradition der Mapuches und Inkas bis hin zu den Hieroglyphen der Azteken und Mayas hatte der Süden Amerikas, wenn er von sich selbst erzählte, ausschließlich sein Gedächtnis im Blick. In künstlerischer wie pragmatischer Hinsicht dienten die Codices genau wie die mündlichen Überlieferungen als Archive und für zeremonielle Zwecke. Die ersten, die dieses geheimnisvolle Territorium aus westlicher Perspektive in den Blick nahmen, waren die Anderen, die Spanier, mit ihren Crónicas de Indias (Entdeckerberichte) und den Heldengeschichten ihrer Eroberer. Nachdem sich deren Sprache durchgesetzt hatte, lernten die Bewohner des Südens – fast wie bei einer Rückeroberung –, diese neue Sprache zu zähmen, ein Vorgang, der jedoch weniger eine Rache an dieser Sprache darstellt, als ein höchst originelles und eigenständiges Ausloten ihrer Grenzen. Nach der Literatur der Kolonialzeit, die noch ganz im Bann des Nordens stand, sind so die Lyrik des Peruaners César Vallejo und des Chilenen Vicente Huidobro Paradebeispiele für die gelungene Aneignung und Verwendung dieser Sprache.
Mit einem meisterhaften Schachzug bestimmt der Chilene Huidobro die paradigmatische Achse, an der entlang sich der Großteil seines Werkes entwickeln wird: „Der vier Himmelsrichtungen sind drei: Süden und Norden“, wie es im Vorwort seines Buches Altazor heißt - kürzestmögliche Entlarvung der Inhaltslosigkeit gewisser Kategorien, scheinbar absurder Übergang zu einer Subversion der Sprache und zugleich Bestimmung der tatsächlichen Koordinaten, an denen die Literatur des amerikanischen Südens sich abarbeiten muss. Andere Autoren wie der Mexikaner Juan Rulfo oder der Peruaner José María Arguedas haben diese Bruchstellen auf je eigene Art untersucht – im Rückgriff auf die erwähnten Koordinaten schrieb Arguedas einen Roman mit dem Titel El zorro de arriba y el zorro de abajo (Der Fuchs von oben und der Fuchs von unten).
Der lateinamerikanische „Boom“
Erst mit dem Boom der lateinamerikanischen Literatur begann man jedoch den Süden als gleichzeitig mythisches, apokalyptisches und karnevaleskes Territorium zu erzählen. Und auch wenn manchem dies nicht gefällt – der von dem von Gabriel García Márquez geschaffenen Ort Macondo ausgehende Stamm bestimmt für den Rest des Planeten bis heute maßgeblich, was der amerikanische Süden ist. Was sich die Literaturkritik wie auch andere Disziplinen, wie Marketing und Werbung, entsprechend zunutze gemacht haben. Eine andere, realistischere Linie aus der Zeit des Booms der lateinamerikanischen Literatur bilden gesellschaftskritische Romane, die diese Weltgegend als eine der puren Machtgier unterworfene Region darstellen. Die diversen Diktaturen des 20. Jahrhunderts bildeten in dieser Hinsicht das Ausgangsmaterial für die Entstehung der Vorstellung von einer Art kollektiver Sehnsucht nach einem
Caudillo (militärischer Anführer) mit messianischen Zügen, die das ihre dazu beigetragen hat, das literarische Bild des Südens zu prägen.
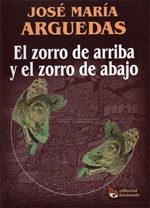 © Editorial Horizonte
In späterer Zeit wiederum hat die lateinamerikanische Literatur auf viele verschiedene Arten versucht, sich von dem durch den Boom erzeugten Bild abzusetzen. Die Postmoderne, mit ihrem Rückgriff auf Elemente des Pop und der freien Wiederverwertung von Traditionen aller Art, ist der endgültige Beweis, dass der Süden als Konzept immer noch von großer Bedeutung für die Schriftsteller dieser Weltgegend ist. Und auch wenn die Suche nach einer gemeinsamen Identität für die Literatur des Südens mittlerweile nicht mehr an erster Stelle steht, scheint zwischen ihren immer stärker vereinzelten Suchbewegungen doch weiterhin die Stimme des uruguayischen Schriftstellers Mario Benedetti hervorzutönen, der, mit einer Feierlichkeit, die heutzutage ein wenig fern wirken mag, verkündet, dass hier unten:
© Editorial Horizonte
In späterer Zeit wiederum hat die lateinamerikanische Literatur auf viele verschiedene Arten versucht, sich von dem durch den Boom erzeugten Bild abzusetzen. Die Postmoderne, mit ihrem Rückgriff auf Elemente des Pop und der freien Wiederverwertung von Traditionen aller Art, ist der endgültige Beweis, dass der Süden als Konzept immer noch von großer Bedeutung für die Schriftsteller dieser Weltgegend ist. Und auch wenn die Suche nach einer gemeinsamen Identität für die Literatur des Südens mittlerweile nicht mehr an erster Stelle steht, scheint zwischen ihren immer stärker vereinzelten Suchbewegungen doch weiterhin die Stimme des uruguayischen Schriftstellers Mario Benedetti hervorzutönen, der, mit einer Feierlichkeit, die heutzutage ein wenig fern wirken mag, verkündet, dass hier unten:
„nah an den Wurzeln
die Erinnerung
nicht das Geringste vergisst,
und so entringen sich die einen
dem Tod, die anderen dem Leben,
und allen zusammen gelingt
das bis dahin Unmögliche,
dass alle Welt weiß: Auch der Süden existiert.“ [1]