Lesetipps für den Sommer
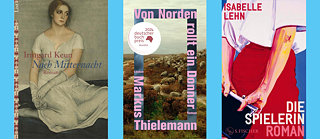
3 neue Lektüretipps von Ela Meyer
Irmgard Keun schreibt in ihrem Roman Nach Mitternacht über die dreißiger Jahre in Frankfurt am Main. Sie lässt ihre Protagonistin durch Kneipen und Cafés ziehen und vermittelt so einen beeindruckenden Einblick in die Zeit nach der Machtergreifung der Nationalsozialist*innen.Der Roman Von Norden rollt ein Donner von Markus Thielemann spielt in der Heidelandschaft und begleitet den Hirten Jannes durch seinen Alltag. Der schlägt sich unter anderem mit der Rückkehr des Wolfes und einem alten Familiengeheimnis herum, einem Verbrechen, das in den Nachkriegsjahren begangen wurde.
Der Roman Die Spielerin von Isabelle Lehn beruht auf wahren Tatsachen und liest sich spannend wie ein Krimi. Die Protagonistin ist Bankerin, arbeitet für die kalabrische Mafia und weiß die Tatsache, als Frau in der Finanzwelt von allen unterschätzt zu werden, zu ihrem Vorteil zu nutzen.
Ela Meyer ist Autorin und lebt in Barcelona.

Nach dem Tod ihrer Mutter zieht die 16jährige Sanna zu ihrer garstigen Tante Adelheid nach Köln, wo sie sich in deren Sohn Franz verliebt. Die Tante ist überzeugte Nationalsozialistin. Nachdem Sanna sich kritisch über Nazi-Politiker geäußert hat, verrät die Tante sie an die Gestapo und Sanna wird verhaftet und verhört.
„Und immer mehr Menschen strömen herbei, das Gestapo-Zimmer scheint die reinste Wallfahrtsstätte. Mütter zeigen ihre Schwiegertöchter an, Töchter ihre Schwiegerväter, Brüder ihre Schwestern, Schwestern ihre Brüder, Freunde ihre Freunde, Stammtischgenossen ihre Stammtischgenossen, Nachbarn ihre Nachbarn“.
Gleich nach den Verhören wird Sanna unverhofft entlassen und flüchtet nach Frankfurt am Main zu ihrem Bruder, einem ehemals erfolgreichen Schriftsteller, der nur noch über Landschaften schreibt, seit seine Bücher von den Nazis verbrannt wurden.
In Frankfurt freundet sie sich mit Jorunalist*innen und Menschen aus der Kunst- und Literaturszene an, denen immer weniger Raum bleibt, sich frei zu bewegen und ihre Meinung zu äußern. Sie leben in ständiger Angst, verraten und verhaftet zu werden, weil sie keinen Ariernachweis liefern können, weil sie die „falsche“ Person lieben, nicht ins Bild der Herrschenden passen, Kritik am Nationalsozialismus üben oder anderweitig politisch aktiv sind.
Die Handlung erstreckt sich über zwei Tage, in denen Sanna und ihre Freund*innen sich durch Kneipen und Cafés treiben lassen. Dabei sprechen sie mit Menschen, die so verzweifelt sind, dass sie ins Exil gehen wollen oder als einzige Lösung den Suizid sehen. Ebenso stoßen sie auf korrupte Blockwarts, machtgierige Parteigenoss*innen, Mitläufer*innen und Aufsteiger*innen, die jederzeit bereit sind, ihre Mitmenschen bei dem kleinsten Verdacht zu denunzieren.
„Wir leben nun einmal in der Zeit der großen deutschen Denunziantenbewegung. Jeder hat jeden zu bewachen, jeder hat Macht über jeden. jeder kann jeden einsperren lassen. Der Versuchung, diese Macht auszuüben, können nur wenige widerstehen.“
Der Showdown findet im Haus des Bruders statt, wo dessen Frau eine Party veranstaltet, zu der viele der Personen eingeladen sind, die Sanna schon zuvor getroffen hat. Bei dem Fest trifft sie auch ihren ehemaligen Liebsten wieder, ihren Cousin Franz, der sich auf der Flucht befindet.
Mit pointierter Ironie und Schärfe schreibt die Autorin über den Alltag im Nationalsozialismus und kritisiert dabei den Führerkult, die Machthungrigkeit und das Mitläufertum eines Großteils der Bevölkerung.
„Was jetzt in Deutschland begann, scheint hoffnungslos ohne Ende. Ein bluttriefendes Riesenrad, dreht Deutschland sich um sich selbst, weiter, immer weiter durch die nächsten Jahrzehnte - [...]“
In ihrem Roman „Nach Mitternacht“, verarbeitet Irmgard Keun ihre eigenen Erfahrungen in Deutschland. Sie schreibt in einem leicht zu lesenden Stil und lässt ihre Figuren häufig in der Umgangssprache erzählen.
Irmgard Keun ging 1936 ins Exil nach Belgien. 1940 kehrte sie unter falschem Namen nach Deutschland zurück. Dieser Roman erschien 1937 im Exil-Verlag Querido.
"Nach Mitternacht" im Bibliothekskatalog
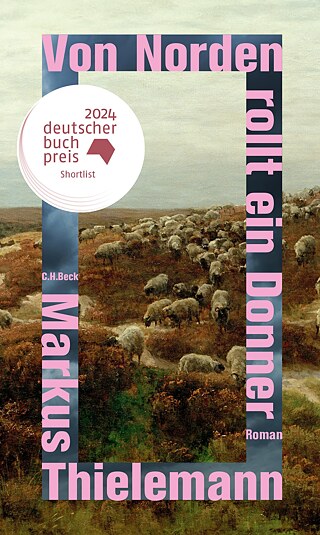
Der Hof von Jannes’ Familie liegt in der Nähe von Faßberg, einer alten NS-Siedlung. Das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen ist 25 Kilometer entfernt. Der Fliegerhorst, heute von der Bundeswehr genutzt, wurde in den Dreißigern von den Nationalsozialist*innen gebaut.
Jannes lebt mit seinen Eltern und seinem Großvater auf dem Hof, die demenzkranke Großmutter ist in einem Heim untergebracht. Auf Jannes liegt viel Hoffnung und Verantwortung.
„Solange er lebt, wird er diese Arbeit machen müssen, sonst können sie gleich aufgeben und den Hof verkaufen. Diese Landschaft hat ihm Stricke um die Glieder gelegt, mit neunzehn.“
Während Jannes mit den Schafen und seinen zwei Hütehunden unterwegs ist, fühlt er sich zunehmend vom Wolf, der in Niedersachsens Wälder zurückgekehrt ist, bedroht. Erste Risse werden gemeldet, in diversen Foren kursieren Fotos von zerfetzten Tieren. Einige der Viehwirte sind für Selbstjustiz, sie sehen sich als Heimatschützer und wollen den ersten Wolf, der sich ihren Herden nähert, am liebsten gleich abknallen.
„Der Wolf gehört eben hier nicht her, Punkt“, ruft einer, „sondern in die Vergangenheit oder in andere Länder. Einfach gesagt, passt er eben nicht in unsere deutsche Kulturlandschaft.“
Befeuert wird die Diskussion vom neuen Nachbarn, an seiner Jacke steckt eine Wolfsangel-Anstecknadel, und er ist großer Anhänger des von den Nationalsozialist*innen verehrten Heidedichters Hermann Löns. Der Wolf wird zur Metapher, steht für alles Fremde, sowohl heute als auch in alten Zeiten, als nach dem Krieg Geflüchtete aus Pommern und aus den Lagern befreite Menschen durch das Land zogen.
Der Roman beschreibt auf interessante Weise das Leben und die Arbeit von Heideschäfer*innen im Laufe der Jahreszeiten. Als Lesende begleitet man Jannes beim Hüten draußen auf der Heide mit den Hunden, beim Füttern im Stall, während der Decksaison und bei der Geburt der ersten Lämmer.
Auf den Spuren des Wolfes, stößt Jannes auf ein altes Familiengeheimnis, ein Verbrechen, das in den Jahren nach dem Krieg begangen wurde. Die Heide bildet in diesem gelungenen Roman eine erlebbare Kulisse, vor der Realität und Mythen, Gegenwart und finstere Vergangenheit sich vermischen.
"Von Norden rollt ein Donner" im Bibliothekskatalog
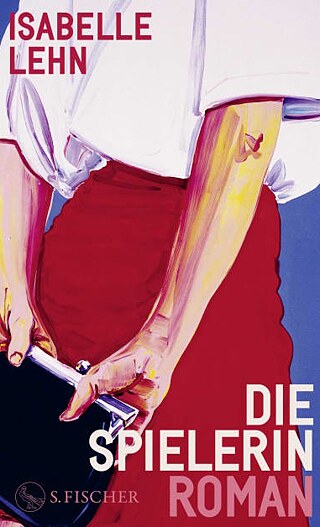
„Heute hieß es, dass sie ihr Leben zum Schein geführt habe. Im Schutz einer Fassade, die ihr Unsichtbarkeit gewährte, während auch er vor drei Jahren noch überzeugt war, dass es A. um Sichtbarkeit ging.“
Anfang der 90er Jahre arbeitet A. als eine der wenigen Frauen für eine große deutsche Bank in Zürich. A. hat Talent und wenig Skrupel. Sie kennt den Spagat zwischen legal und legitim und durchschaut schnell, wie eng verwoben Banken, Politik, Wirtschaft und Mafia sind. Sie entwickelt sich zu einem Profi und arbeitet sich empor. Von ihr als Frau wird erwartet, sich im Hintergrund zu halten, unschuldig zu tun und so das Vertrauen potentieller Kund*innen zu gewinnen.
Der Roman rollt A.‘s Geschichte von hinten auf und beginnt mit ihrem Gerichtsprozess. Durch Zeug*innenbefragungen bekommt man einen ersten Eindruck von ihr.
„Ausgerechnet A. also, diese farblose, matte Person, die „zu spät“ vielleicht schon hinter sich hatte und vom Leben nichts mehr erwartet, soll ihn nun mit etwas Größerem verbinden, als ihm zuvor je begegnet ist.“
Der zweite Teil des Romans, der sich um A’s Karriere als Investmentbankerin dreht, wird zum Teil aus der Wir-Perspektive erzählt. Dahinter versteckt sich die kalabrische Mafia. Die ist schon länger an A. interessiert, da diese geschickt, ehrgeizig, intelligent und genau richtig unauffällig ist. Eine, die weiß, wie wichtig es ist, unterschätzt zu werden. Als A. von ihrem Job in der Zürcher Bank freigestellt wird, nimmt sie das Angebot der kalabrischen Mafia an, für sie zu arbeiten.
Souverän fügt Isabelle Lehn im letzten Teil des Romans alle losen Fäden zusammen. A. ist bis zum Ende schwer greifbar, ihre Figur bleibt nebulös und spiegelt damit im Roman genau die Rolle wider, die A. auch als Geschäftsfrau innehat. Mit viel Geschick weiß A. die Strukturen von Patriarchat und Kapitalismus zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen, und wird auch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere von ihren männlichen Kollegen nicht ernst genommen, selbst nicht, als sie sie längst alle an der Nase herumgeführt und getäuscht hat.
Fazit: Ein gut recherchierter, spannender Roman.
"Die Spielerin" im Bibliothekskatalog