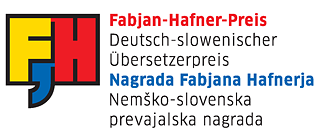Fabjan-Hafner-Preis
Übersetzerpreis
Das Goethe-Institut Ljubljana präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten, dem Literarischen Colloquium Berlin (LCB), dem Musil-Institut/Kärntner Literaturarchiv (Universität Klagenfurt), dem Verband slowenischer Literaturübersetzer und Übersetzerinnen (DSKP), dem Österreichischen Kulturforum Laibach und der Slowenischen Buchagentur (JAK) den „Fabjan-Hafner-Preis“, der die besten Übersetzerinnen und Übersetzer aus dem Slowenischen ins Deutsche und umgekehrt auszeichnet. Der Preis ist nach dem für Slowenien besonders wichtigen Übersetzer, Dichter und Literaturwissenschaftler Fabjan Hafner (1966–2016) benannt. 2017 wurde der Preis erstmalig für eine herausragende Übersetzung aus dem Deutschen ins Slowenische verliehen. 2018 wurde der Preis für die beste Übersetzung aus dem Slowenischen ins Deutsche verliehen. In diesem Wechsel sollten die Preisverleihungen auch in den kommenden Jahren stattfinden.
Der Hauptpreis beinhaltet ein Stipendium für einen 1-monatigen Residenzaufenthalt beim Literarischen Colloquium Berlin (mit finanzieller Unterstützung des Goethe-Instituts Ljubljana) und einen Geldpreis in Höhe von 5.000 € (gestiftet vom Land Kärnten). Der Anerkennungspreis beinhaltet einen Geldpreis in Höhe von 2.500 € (gestiftet vom Österreichischen Kulturforum).
Zwei Jurys wählen jeweils die beste Übersetzung aus. Eine deutschsprachige Jury wählt die Übersetzungen aus dem Slowenischen ins Deutsche aus, die slowenischsprachige Jury die Übersetzungen aus dem Deutschen ins Slowenische.
Der Hauptpreis beinhaltet ein Stipendium für einen 1-monatigen Residenzaufenthalt beim Literarischen Colloquium Berlin (mit finanzieller Unterstützung des Goethe-Instituts Ljubljana) und einen Geldpreis in Höhe von 5.000 € (gestiftet vom Land Kärnten). Der Anerkennungspreis beinhaltet einen Geldpreis in Höhe von 2.500 € (gestiftet vom Österreichischen Kulturforum).
Zwei Jurys wählen jeweils die beste Übersetzung aus. Eine deutschsprachige Jury wählt die Übersetzungen aus dem Slowenischen ins Deutsche aus, die slowenischsprachige Jury die Übersetzungen aus dem Deutschen ins Slowenische.
Für die herausragende Übersetzung des Romans „Ikarien“ (Kiepenheuer & Witsch Verlag, 2017) von Uwe Timm („Ikarija“, Verlag .cf*, Herausgeberin: Amelia Kraigher) wird der Fabjan-Hafner-Preis für das Jahr 2025 nach der Beurteilung der Fachjury – in der folgenden Zusammensetzung: Daniela Kocmut, Aljaž Koprivnikar und Katja Stergar – der Übersetzerin Mojca Kranjc zugesprochen.
BEGRÜNDUNG DER JURY
Als zentrale Mitarbeiterin des Slowenischen Nationaltheaters Drama Ljubljana hat Mojca Kranjc in den letzten Jahrzehnten einen Referenzstandard für Genauigkeit und stilistische Raffinesse bei der Übertragung deutscher Dramatik, Essayistik und Prosa ins Slowenische gesetzt. Ihre Arbeit verbindet auf vorbildliche Weise die Sensibilität für das Repertoire der Theaterpraxis mit der filigranen Präzision der literarischen Übersetzung. Sie hat klassische und zeitgenössische Stimmen in den slowenischen Raum übertragen und die Sprache der slowenischen Bühnen- und Übersetzungskultur mitgeprägt. In der Essayistik und Theorie bleiben ihre Übersetzungen ein Maßstab für interpretative Konsequenz und terminologische Souveränität.
In einer komplexen Montage aus Tagebuchaufzeichnungen, Verhördialogen und Erzählungen in der dritten Person entfaltet „Ikarien“/“Ikarija“ die Genealogie utopischer Träume und deren Abgleiten in biopolitische Gewalt. Die Übersetzung erfordert ein außergewöhnliches Spektrum: von lebendigen, rhythmisch-konversationellen Registern bis hin zu einer kühlen, dokumentarischen, konzeptuell aufgeladenen Sprache. Mojca Kranjc beherrscht alle Ebenen überzeugend: Mit ausgefeilter Syntax bewahrt sie Timms narrative Polyphonie, gleicht terminologische Präzision mit Lesbarkeit aus und mildert tonale Übergänge in flüssiges, idiomatisches Slowenisch, ohne die Ironie des Autors und die intellektuelle Spannung zu verwischen. So wirkt der Roman über die „Wende” der Utopie zur Disziplinierung von Körpern und Gesellschaft auch im slowenischen Raum als weitreichende historische, politische und philosophische Reflexion unserer Zeit.
Die Übersetzung von Mojca Kranjc setzt gleichzeitig ihre erkennbare Poetik der Präzision fort: Aus Mikrodetails der Sprache und des Stils filtert sie den Charakter, den ideellen Horizont und den historischen Kontext heraus – Elemente, die von der kritischen Rezeption als Kern von Timms Roman erkannt werden. Mit einer Auswahl von Strategien, die die semantische Bedeutung des Originals respektieren und auf die Ausdruckskraft der slowenischen Sprache vertrauen, verkörpert sie das Ideal dieses Preises: eine dauerhafte, verantwortungsvolle und ästhetisch überzeugende Vermittlung literarischen Denkens zwischen den beiden Kulturen: mit dieser Entscheidung würdigen wir Mojca Kranjc für ihre herausragende Übersetzungsarbeit, die durch „Ikarija“ und ihr gesamtes Oeuvre bestätigt wird.
ÜBER DIE PREISTRÄGERIN
Mojca Kranjc ist Dramaturgin und Herausgeberin von Publikationen am Slowenischen Nationaltheater Drama Ljubljana sowie Übersetzerin von Belletristik, Essays und theoretischen Texten ins Slowenische, vor allem aus dem Deutschen. Für den Verlag /*cf. hat sie Bertolt Brechts Schauspiel Die heilige Johanna der Schlachthöfe, Andrea Komlosys wissenschaftliche Monografie Arbeit, Carolin Emckes Essay Ja heißt ja und … sowie Uwe Timms Roman Ikarien übersetzt. Für ihre „Leistungen in der slowenischen Dramaturgie“ erhielt sie im Jahr 2009 den Grün-Filipič-Preis und für ihre Übersetzungstätigkeit im Jahr 2015 den Sovre-Preis.
ANERKENNUNGSPREIS
Der Anerkennungspreis für die beste Übersetzung im Bereich Kinder- und Jugendliteratur geht an Anja Zag Golob für ihre Übersetzung des Jugendromans „Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte“ (Hanser Verlag, 2019) von Dita Zipfel („Kako mi je norost razložila svet“, Mladinska knjiga, 2023, Herausgeberin: Alenka Veler).
BEGRÜNDUNG DER JURY
Das Original, das mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 ausgezeichnet wurde, ist stilistisch gewagt: Es wechselt zwischen dem inneren Monolog der dreizehnjährigen Erzählerin, Straßenslang, Wortspielen, absurdem Humor und den lyrischen Abschweifungen des Herrn Klinge. Eine solche Verflechtung erfordert eine Übersetzung, die gleichzeitig präzise und mutig ist. Anja Zag Golob bewahrt meisterhaft die Lebhaftigkeit und den Rhythmus der Stimme: Die Dialoge fließen natürlich, die Redewendungen sind einfallsreich übersetzt, Neologismen und sprachliche Einfälle wirken im Slowenischen effektiv und nicht wie Erklärungen. Wo eine kulturelle Anpassung erforderlich ist, ist diese diskret; das Tempo bleibt lebendig, ohne die Leserschaft zu unterschätzen und ohne zu moralisieren. Das Ergebnis ist eine idiomatische, luftige und den Ausdruck betreffend mutige slowenische Sprache, die jungen Leserinnen und Lesern einen direkten Zugang zur Stimme der Hauptfigur und zu den Themen der Andersartigkeit ermöglicht.
Anja Zag Golob ist eine mehrfach ausgezeichnete Lyrikerin, Übersetzerin und Herausgeberin. In dieser Übersetzung verbindet sie poetische Schärfe mit übersetzerischer Findigkeit: Sie wählt den Ton genau, bewahrt humorvolle Wendungen und schützt mit durchdachten Lösungen den Ton des Originals. Diese Balance zwischen der Geschmeidigkeit der Sprache und der übersetzerischen Disziplin rechtfertigt überzeugend diese Auszeichnung.
ÜBER DIE PREISTRÄGERIN
Anja Zag Golob ist Dichterin und eine der Mitbegründerinnen des Verlags „VigeVageKnjige“, wo sie seit 2013 als Chefredakteurin tätig ist. Darüber hinaus schreibt sie Kolumnen und übersetzt gelegentlich. Sie hat Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana studiert. Für ihre Gedichtbände „Vesa v zgibi“ (2014) und „Didaskalije k dihanju“ (2016) erhielt sie den Jenko-Preis, für den Band „da ne“ (2020) den Preis „kritiško sito“. Sie lebt in Maribor.
BEGRÜNDUNG DER JURY
Als zentrale Mitarbeiterin des Slowenischen Nationaltheaters Drama Ljubljana hat Mojca Kranjc in den letzten Jahrzehnten einen Referenzstandard für Genauigkeit und stilistische Raffinesse bei der Übertragung deutscher Dramatik, Essayistik und Prosa ins Slowenische gesetzt. Ihre Arbeit verbindet auf vorbildliche Weise die Sensibilität für das Repertoire der Theaterpraxis mit der filigranen Präzision der literarischen Übersetzung. Sie hat klassische und zeitgenössische Stimmen in den slowenischen Raum übertragen und die Sprache der slowenischen Bühnen- und Übersetzungskultur mitgeprägt. In der Essayistik und Theorie bleiben ihre Übersetzungen ein Maßstab für interpretative Konsequenz und terminologische Souveränität.
In einer komplexen Montage aus Tagebuchaufzeichnungen, Verhördialogen und Erzählungen in der dritten Person entfaltet „Ikarien“/“Ikarija“ die Genealogie utopischer Träume und deren Abgleiten in biopolitische Gewalt. Die Übersetzung erfordert ein außergewöhnliches Spektrum: von lebendigen, rhythmisch-konversationellen Registern bis hin zu einer kühlen, dokumentarischen, konzeptuell aufgeladenen Sprache. Mojca Kranjc beherrscht alle Ebenen überzeugend: Mit ausgefeilter Syntax bewahrt sie Timms narrative Polyphonie, gleicht terminologische Präzision mit Lesbarkeit aus und mildert tonale Übergänge in flüssiges, idiomatisches Slowenisch, ohne die Ironie des Autors und die intellektuelle Spannung zu verwischen. So wirkt der Roman über die „Wende” der Utopie zur Disziplinierung von Körpern und Gesellschaft auch im slowenischen Raum als weitreichende historische, politische und philosophische Reflexion unserer Zeit.
Die Übersetzung von Mojca Kranjc setzt gleichzeitig ihre erkennbare Poetik der Präzision fort: Aus Mikrodetails der Sprache und des Stils filtert sie den Charakter, den ideellen Horizont und den historischen Kontext heraus – Elemente, die von der kritischen Rezeption als Kern von Timms Roman erkannt werden. Mit einer Auswahl von Strategien, die die semantische Bedeutung des Originals respektieren und auf die Ausdruckskraft der slowenischen Sprache vertrauen, verkörpert sie das Ideal dieses Preises: eine dauerhafte, verantwortungsvolle und ästhetisch überzeugende Vermittlung literarischen Denkens zwischen den beiden Kulturen: mit dieser Entscheidung würdigen wir Mojca Kranjc für ihre herausragende Übersetzungsarbeit, die durch „Ikarija“ und ihr gesamtes Oeuvre bestätigt wird.
ÜBER DIE PREISTRÄGERIN

ANERKENNUNGSPREIS
Der Anerkennungspreis für die beste Übersetzung im Bereich Kinder- und Jugendliteratur geht an Anja Zag Golob für ihre Übersetzung des Jugendromans „Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte“ (Hanser Verlag, 2019) von Dita Zipfel („Kako mi je norost razložila svet“, Mladinska knjiga, 2023, Herausgeberin: Alenka Veler).
BEGRÜNDUNG DER JURY
Das Original, das mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 ausgezeichnet wurde, ist stilistisch gewagt: Es wechselt zwischen dem inneren Monolog der dreizehnjährigen Erzählerin, Straßenslang, Wortspielen, absurdem Humor und den lyrischen Abschweifungen des Herrn Klinge. Eine solche Verflechtung erfordert eine Übersetzung, die gleichzeitig präzise und mutig ist. Anja Zag Golob bewahrt meisterhaft die Lebhaftigkeit und den Rhythmus der Stimme: Die Dialoge fließen natürlich, die Redewendungen sind einfallsreich übersetzt, Neologismen und sprachliche Einfälle wirken im Slowenischen effektiv und nicht wie Erklärungen. Wo eine kulturelle Anpassung erforderlich ist, ist diese diskret; das Tempo bleibt lebendig, ohne die Leserschaft zu unterschätzen und ohne zu moralisieren. Das Ergebnis ist eine idiomatische, luftige und den Ausdruck betreffend mutige slowenische Sprache, die jungen Leserinnen und Lesern einen direkten Zugang zur Stimme der Hauptfigur und zu den Themen der Andersartigkeit ermöglicht.
Anja Zag Golob ist eine mehrfach ausgezeichnete Lyrikerin, Übersetzerin und Herausgeberin. In dieser Übersetzung verbindet sie poetische Schärfe mit übersetzerischer Findigkeit: Sie wählt den Ton genau, bewahrt humorvolle Wendungen und schützt mit durchdachten Lösungen den Ton des Originals. Diese Balance zwischen der Geschmeidigkeit der Sprache und der übersetzerischen Disziplin rechtfertigt überzeugend diese Auszeichnung.
ÜBER DIE PREISTRÄGERIN

Für die herausragende Übersetzung zahlreicher Gedichte von Srečko Kosovel, die in dem Band „Mein Gedicht ist mein Gesicht: Invention einer orphischen Landschaft“ erschienen sind (Otto Müller Verlag, 2023), wird der Fabjan-Hafner-Preis für das Jahr 2023 nach der Beurteilung der Fachjury – in der folgenden Zusammensetzung: Dr. Neva Šlibar (Vorsitzende), Dr. Lars Felgner und Zdenka Hafner-Čelan – dem Übersetzer Ludwig Hartinger zugesprochen.
Der Fabjan-Hafner-Preis für das Jahr 2023 wird im Rahmen des Auftritts Sloweniens als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse feierlich am 21.10.2023 um 17:00 Uhr im Ehrengast-Pavillon (Maruša-Krese-Bühne) verliehen. Der Preis für die beste Übersetzung aus dem Slowenischen ins Deutsche wird von der Präsidentin des Goethe-Instituts Prof. Dr. Carola Lentz verliehen.
BEGRÜNDUNG DER JURY
„Wo war eigentlich ein Gedicht, während es aus der einen Sprache in die andere übersetzt wurde?“ sinniert die Protagonistin in einem Roman von Jenny Erpenbeck und rührt damit an die Grenzen des Fassbaren. Auf diese Frage des „Niemandslandes der Worte“ hätte Fabjan Hafner, dessen Gedenken wir mit dieser Preisverleihung ehren, gewiss eine ebenso poetische wie überzeugende Antwort. Im Dazwischen beheimatet, weil jede feste Zugehörigkeit auch die Zumutung der Festlegung enthält, verdichtete er das schöpferische Arbeiten in das eindringliche Bild: „Schreiben von Gedichten / ist Übersetzen / aus einer Sprache / die es nicht gibt.“
Ludwig Hartinger sieht sich selbst in diesem Sinne als „Wortschmuggler“, slowenisch „tihotapec besed“, wobei das slowenische Wort nicht nur melodischer klingt als das deutsche, sondern vor allem das Herumirren in Stille und Dunkelheit konnotiert, eine Tätigkeit, die der des Dichtens und Über-Setzens ähnelt. 1952 in Saalfelden am Steinernen Meer geboren, betätigte er sich ab 1985 als Lektor und Talent Scout bei verschiedenen Verlagen, war ab 1991 Redakteur der Zeitschrift „Literatur und Kritik“, ist Übersetzer aus dem Französischen und Slowenischen, Kulturvermittler und Dichter. In den achtziger Jahren stieß er in Frankreich auf Srečko Kosovels Gedichte. Der ikonische junge Dichter, sein ausnehmend vielfältiges Werk und die häufig von ihm besungene Landschaft, mit der er sich identifizierte, nämlich der Karst oberhalb von Triest, wurden für Hartinger lebensprägend. Er lernte slowenisch, vertiefte sich in Kosovels Dichtungen, durchforstete sie bis in den unveröffentlichten Nachlass hinein, stellte Unbekanntes dem slowenischen Publikum vor, sodass er heute der vermutlich profundeste Kenner des bereits mit zweiundzwanzig Jahren Verstorbenen ist.
Das Buch „Mein Gedicht ist mein Gesicht“ ist viel mehr als eine Ansammlung von Gedichtübersetzungen; Hartingers Kenntnis von Srečko Kosovels Oeuvre befähigte ihn, eine auf das deutschsprachige Lesepublikum hin konzipierte Gesamtschau des Dichters zu inszenieren. Die Vielfalt des im Buch versammelten Opus – lyrische Naturgedichte, apokalyptische Gedichte über das Ende Europas, konstruktivistische oder avantgardistische Gedichte und dazwischen Prosatexte – stellt für jeden Übersetzer eine große Herausforderung dar. Hinzu kommt der unverwechselbare Tonfall vieler Gedichte, die in der Kargheit einfacher Worte und ihrer ganz besonderen rhythmischen Anordnung begründet liegt. Aus solchen Bildgefügen und Klangfarben entstehen Gedichte, die in ihrer scheinbaren Einfachheit dennoch ungemein komplex sind, da in ihnen intensive Naturempfindungen, existentielle Erfahrungen und die im Hintergrund lauernden historisch-politischen Widersprüche der Zeit auf eine unnachahmliche Art ineinander verwoben werden. Unnachahmlich bedeutet jedoch nicht automatisch unübersetzbar; die große Kunst des Übersetzens, nämlich die Übersetzung so klingen zu lassen, als wäre sie ein Original, gelingt Ludwig Hartinger in der Sprachkombination Slowenisch-Deutsch meisterhaft. Auch durch die Entscheidung, nicht alle Reime zwanghaft ins Deutsche zu übertragen, sondern stattdessen mit klanglichen Farben und rhythmischen Wortfügungen zu arbeiten, kommt er dem, was Kosovels Poesie ausmacht, sehr nah. Ludwig Hartinger erweist sich durch seine intelligenten und kreativen Lösungen für die vielen Übersetzungsprobleme, vor die man beim Übertragen von Kosovels Lyrik ins Deutsche gestellt wird, als würdiger Träger des Fabjan-Hafner Preises.
ÜBER DEN PREISTRÄGER
Geboren 1952 in Saalfelden am Steinernen Meer. Seit 1985 Lektor bei verschiedenen Verlagen, derzeit beim Otto Müller Verlag und der Edition Thanhäuser. Veröffentlicht Essays und Gedichte in slowenischer und deutscher Sprache („Ostrina bilk“, Ljubljana 2007; „Die Schärfe des Halms – Aus dem dichterischen Tagebuch 2001–2012“, Edition Thanhäuser 2012; „anderwort/anderlicht“, 2013; „Vom Verlauf des Blicks“, 2013; „Schatten säumen – Aus dem dichterischen Tagebuch 2012-2017“, Otto Müller 2018 und „Leerzeichen – Aus dem dichterischen Tagebuch 2018-2022“, Otto Müller 2022) sowie Übersetzungen aus dem Slowenischen (u. a. Srečko Kosovel, Tomaž Šalamun, Dane Zajc, Aleš Debeljak, Aleš Šteger, Maja Vidmar) und Französischen (u. a. Pierre Reverdy, Fiston Mwanza Mijula). Auszeichnungen: 2004 Preis der Central-European-Initiative, 2004 Tone-Pretnar-Preis (Botschafter der slowenischen Literatur), 2022 Lavrin-Diplom (Verband slowenischer Literaturübersetzer und Übersetzerinnen). Lebt in Saalfelden und zeitweise auf dem Karst.
LOBENDE ERWÄHNUNG
Zum dritten Mal in der Geschichte des Fabjan-Hafner-Preises wird in diesem Jahr noch eine weitere Auszeichnung verliehen. Besonders hervorheben und erwähnen möchte die Jury die äußerst gelungene Übersetzung, die Alexandra Natalie Zaleznik mit dem Kinderbuch „Ein Haus für Hase“ von Anja Štefan vorgelegt hat. Damit soll nicht nur die Leistung der jungen Übersetzerin gewürdigt werden, sondern auch die kulturelle Bedeutung der Kinder- und Jugendliteratur, die bedauerlicherweise gegenüber anderen Genres meist das Nachsehen hat. Im slowenischen Kulturraum spielt diese, seit alters von höchster Qualität sowohl in den Texten wie auch in den Illustrationen, eine ganz besonders wichtige identitätsstiftende und generationenübergreifende Rolle.
SCHIRMHERRSCHAFT
Der Preis steht unter der Schirmherrschaft der Präsidentin des Goethe-Instituts Prof. Dr. Carola Lentz, des Landeshauptmanns von Kärnten Dr. Peter Kaiser, der Österreichischen Botschafterin in Slowenien Mag. Elisabeth Ellison-Kramer und der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Slowenien, Natalie Kauther und Adrian Pollmann.
Der Fabjan-Hafner-Preis für das Jahr 2023 wird im Rahmen des Auftritts Sloweniens als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse feierlich am 21.10.2023 um 17:00 Uhr im Ehrengast-Pavillon (Maruša-Krese-Bühne) verliehen. Der Preis für die beste Übersetzung aus dem Slowenischen ins Deutsche wird von der Präsidentin des Goethe-Instituts Prof. Dr. Carola Lentz verliehen.
BEGRÜNDUNG DER JURY
„Wo war eigentlich ein Gedicht, während es aus der einen Sprache in die andere übersetzt wurde?“ sinniert die Protagonistin in einem Roman von Jenny Erpenbeck und rührt damit an die Grenzen des Fassbaren. Auf diese Frage des „Niemandslandes der Worte“ hätte Fabjan Hafner, dessen Gedenken wir mit dieser Preisverleihung ehren, gewiss eine ebenso poetische wie überzeugende Antwort. Im Dazwischen beheimatet, weil jede feste Zugehörigkeit auch die Zumutung der Festlegung enthält, verdichtete er das schöpferische Arbeiten in das eindringliche Bild: „Schreiben von Gedichten / ist Übersetzen / aus einer Sprache / die es nicht gibt.“
Ludwig Hartinger sieht sich selbst in diesem Sinne als „Wortschmuggler“, slowenisch „tihotapec besed“, wobei das slowenische Wort nicht nur melodischer klingt als das deutsche, sondern vor allem das Herumirren in Stille und Dunkelheit konnotiert, eine Tätigkeit, die der des Dichtens und Über-Setzens ähnelt. 1952 in Saalfelden am Steinernen Meer geboren, betätigte er sich ab 1985 als Lektor und Talent Scout bei verschiedenen Verlagen, war ab 1991 Redakteur der Zeitschrift „Literatur und Kritik“, ist Übersetzer aus dem Französischen und Slowenischen, Kulturvermittler und Dichter. In den achtziger Jahren stieß er in Frankreich auf Srečko Kosovels Gedichte. Der ikonische junge Dichter, sein ausnehmend vielfältiges Werk und die häufig von ihm besungene Landschaft, mit der er sich identifizierte, nämlich der Karst oberhalb von Triest, wurden für Hartinger lebensprägend. Er lernte slowenisch, vertiefte sich in Kosovels Dichtungen, durchforstete sie bis in den unveröffentlichten Nachlass hinein, stellte Unbekanntes dem slowenischen Publikum vor, sodass er heute der vermutlich profundeste Kenner des bereits mit zweiundzwanzig Jahren Verstorbenen ist.
Das Buch „Mein Gedicht ist mein Gesicht“ ist viel mehr als eine Ansammlung von Gedichtübersetzungen; Hartingers Kenntnis von Srečko Kosovels Oeuvre befähigte ihn, eine auf das deutschsprachige Lesepublikum hin konzipierte Gesamtschau des Dichters zu inszenieren. Die Vielfalt des im Buch versammelten Opus – lyrische Naturgedichte, apokalyptische Gedichte über das Ende Europas, konstruktivistische oder avantgardistische Gedichte und dazwischen Prosatexte – stellt für jeden Übersetzer eine große Herausforderung dar. Hinzu kommt der unverwechselbare Tonfall vieler Gedichte, die in der Kargheit einfacher Worte und ihrer ganz besonderen rhythmischen Anordnung begründet liegt. Aus solchen Bildgefügen und Klangfarben entstehen Gedichte, die in ihrer scheinbaren Einfachheit dennoch ungemein komplex sind, da in ihnen intensive Naturempfindungen, existentielle Erfahrungen und die im Hintergrund lauernden historisch-politischen Widersprüche der Zeit auf eine unnachahmliche Art ineinander verwoben werden. Unnachahmlich bedeutet jedoch nicht automatisch unübersetzbar; die große Kunst des Übersetzens, nämlich die Übersetzung so klingen zu lassen, als wäre sie ein Original, gelingt Ludwig Hartinger in der Sprachkombination Slowenisch-Deutsch meisterhaft. Auch durch die Entscheidung, nicht alle Reime zwanghaft ins Deutsche zu übertragen, sondern stattdessen mit klanglichen Farben und rhythmischen Wortfügungen zu arbeiten, kommt er dem, was Kosovels Poesie ausmacht, sehr nah. Ludwig Hartinger erweist sich durch seine intelligenten und kreativen Lösungen für die vielen Übersetzungsprobleme, vor die man beim Übertragen von Kosovels Lyrik ins Deutsche gestellt wird, als würdiger Träger des Fabjan-Hafner Preises.
ÜBER DEN PREISTRÄGER
Geboren 1952 in Saalfelden am Steinernen Meer. Seit 1985 Lektor bei verschiedenen Verlagen, derzeit beim Otto Müller Verlag und der Edition Thanhäuser. Veröffentlicht Essays und Gedichte in slowenischer und deutscher Sprache („Ostrina bilk“, Ljubljana 2007; „Die Schärfe des Halms – Aus dem dichterischen Tagebuch 2001–2012“, Edition Thanhäuser 2012; „anderwort/anderlicht“, 2013; „Vom Verlauf des Blicks“, 2013; „Schatten säumen – Aus dem dichterischen Tagebuch 2012-2017“, Otto Müller 2018 und „Leerzeichen – Aus dem dichterischen Tagebuch 2018-2022“, Otto Müller 2022) sowie Übersetzungen aus dem Slowenischen (u. a. Srečko Kosovel, Tomaž Šalamun, Dane Zajc, Aleš Debeljak, Aleš Šteger, Maja Vidmar) und Französischen (u. a. Pierre Reverdy, Fiston Mwanza Mijula). Auszeichnungen: 2004 Preis der Central-European-Initiative, 2004 Tone-Pretnar-Preis (Botschafter der slowenischen Literatur), 2022 Lavrin-Diplom (Verband slowenischer Literaturübersetzer und Übersetzerinnen). Lebt in Saalfelden und zeitweise auf dem Karst.
LOBENDE ERWÄHNUNG
Zum dritten Mal in der Geschichte des Fabjan-Hafner-Preises wird in diesem Jahr noch eine weitere Auszeichnung verliehen. Besonders hervorheben und erwähnen möchte die Jury die äußerst gelungene Übersetzung, die Alexandra Natalie Zaleznik mit dem Kinderbuch „Ein Haus für Hase“ von Anja Štefan vorgelegt hat. Damit soll nicht nur die Leistung der jungen Übersetzerin gewürdigt werden, sondern auch die kulturelle Bedeutung der Kinder- und Jugendliteratur, die bedauerlicherweise gegenüber anderen Genres meist das Nachsehen hat. Im slowenischen Kulturraum spielt diese, seit alters von höchster Qualität sowohl in den Texten wie auch in den Illustrationen, eine ganz besonders wichtige identitätsstiftende und generationenübergreifende Rolle.
SCHIRMHERRSCHAFT
Der Preis steht unter der Schirmherrschaft der Präsidentin des Goethe-Instituts Prof. Dr. Carola Lentz, des Landeshauptmanns von Kärnten Dr. Peter Kaiser, der Österreichischen Botschafterin in Slowenien Mag. Elisabeth Ellison-Kramer und der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Slowenien, Natalie Kauther und Adrian Pollmann.
Für die herausragende Übersetzung „Moje leto v Nikogaršnjem zalivu“ („Mein Jahr in der Niemandsbucht“ von Peter Handke), erschienen 2021 beim Verlag Beletrina, wird der Fabjan-Hafner-Preis für das Jahr 2021 nach der Beurteilung der Fachjury – in der folgenden Zusammensetzung: Anja Naglič (Vorsitzende), Tanja Petrič und Renata Zamida – der Übersetzerin Dr. Amalija Maček zugesprochen.
BEGRÜNDUNG DER JURY
Amalija Maček ist Übersetzerin, Dolmetscherin und Translationswissenschaftlerin mit einer beeindruckenden Anzahl an Übersetzungen literarischer und humanistischer Werke aus dem Deutschen. Sie leistet wertvolle Arbeit als Förderin und Vermittlerin slowenischer Literatur im deutschsprachigen Raum, wobei sie mit besonderem Engagement slowenischen Autorinnen und slowenischer Poesie die Tür öffnet und so – ganz im Sinne des Fabjan-Hafner-Preises – für den Austausch zwischen slowenischen und deutschen Kulturkreisen sorgt. Sie übersetzte ältere und moderne Klassiker, beispielsweise von Franz Kafka, Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Marlen Haushofer, Ilse Aichinger, Ilma Rakusa, Josef Winkler und Terézia Mora. Ihre reiche Übersetzungsbibliografie umfasst ebenso Werke der Nobelpreisträger Elfriede Jelinek und Peter Handke, die für jeden Übersetzer eine außergewöhnliche sprachliche Herausforderung darstellen.
Nach zwei kürzeren Werken von Handke – „Versuch über den Pilznarren“ („Poskus o norem gobarju“, erschienen bei Mohorjeva Hermagoras, Klagenfurt, 2014) und „Wunschloses Unglück“ („Žalost onkraj sanj“, Beletrina, Ljubljana, 2020) – nahm Amalija Maček die Übersetzung seines komplexen und umfangreichen Romans „Mein Jahr in der Niemandsbucht“ („Moje leto v Nikogaršnjem zalivu“, Beletrina, 2021) in Angriff. Sie übersetzte ihn über viele Jahre hinweg äußerst geduldig und genau. Das Ergebnis ist ein übersetzerisches Meisterwerk. Es gibt nur wenige Übersetzungen, die so sehr auf das Original eingestimmt sind. Handkes aneinandergereihte, wellenförmige, manchmal widersprüchliche Satzstrukturen, die durch das Subjekt/den Beobachter/den Erzähler mal subtil, mal egozentrisch auch die Perspektiven anderer Personen herleiten, wurden von der Übersetzerin im Slowenischen sprachlich und syntaktisch perfekt nachgebildet, ohne dabei ihre logische Reihenfolge zu brechen oder die Aussagekraft zu verschleiern. Auch in Klang und Rhythmus gelang es ihr, den für Handke charakteristischen Erzählfluss nachzugestalten. Mit ihren – gemäß einer feinfühligen adaptierenden Strategie – Übersetzungsentscheidungen und ihrer Wortwahl entfaltet sie den ganzen Reichtum der slowenischen Sprache und zeigt auf, was in ihr sprachlich möglich ist. Dies ist nicht nur eine herausragende Leistung auf dem Gebiet der Übersetzung aus dem Deutschen, sondern auch ein Werk, das aus der gesamten in den letzten Jahren ins Slowenische übersetzten Literatur hervorsticht.
ÜBER DIE PREISTRÄGERIN
Amalija Maček wurde 1971 in Ljubljana geboren. Sie studierte Germanistik und Hispanistik an der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana und erwarb ihren Magister- und Doktortitel in deutscher Gegenwartsliteratur mit den Schwerpunkten Lyrik und Orientalistik. Ihr Studium setzte sie in Tübingen, Berlin, Leipzig und Granada fort. Sie wirkte an den europäischen Projekten EULITA, TRAFUT, TransStar Europa und TraiLLD mit. Seit 2008 ist sie akkreditierte Dolmetscherin für EU-Institutionen und koordiniert den Masterstudiengang Dolmetschen an der Abteilung für Übersetzen der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana, wo sie seit 2001 angestellt ist. Darüber hinaus ist sie Koordinatorin des universitären Programms zur beruflichen Weiterbildung von Gerichts- und Amtsdolmetschern und Mitglied des Verbandes slowenischer Literaturübersetzer (DSKP) sowie des slowenischen Konferenzdolmetscherverbandes (ZKTS). Für ihre literarischen Übersetzungen erhielt sie die Prämie der Kunstsektion des österreichischen Bundeskanzleramtes. Im Jahr 2021 war sie unter den drei Finalistinnen für den Preis Sovretova nagrada (jährlich vom DSKP verliehene Auszeichnung für herausragende Literaturübersetzungen).
BEGRÜNDUNG DER JURY
Amalija Maček ist Übersetzerin, Dolmetscherin und Translationswissenschaftlerin mit einer beeindruckenden Anzahl an Übersetzungen literarischer und humanistischer Werke aus dem Deutschen. Sie leistet wertvolle Arbeit als Förderin und Vermittlerin slowenischer Literatur im deutschsprachigen Raum, wobei sie mit besonderem Engagement slowenischen Autorinnen und slowenischer Poesie die Tür öffnet und so – ganz im Sinne des Fabjan-Hafner-Preises – für den Austausch zwischen slowenischen und deutschen Kulturkreisen sorgt. Sie übersetzte ältere und moderne Klassiker, beispielsweise von Franz Kafka, Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Marlen Haushofer, Ilse Aichinger, Ilma Rakusa, Josef Winkler und Terézia Mora. Ihre reiche Übersetzungsbibliografie umfasst ebenso Werke der Nobelpreisträger Elfriede Jelinek und Peter Handke, die für jeden Übersetzer eine außergewöhnliche sprachliche Herausforderung darstellen.
Nach zwei kürzeren Werken von Handke – „Versuch über den Pilznarren“ („Poskus o norem gobarju“, erschienen bei Mohorjeva Hermagoras, Klagenfurt, 2014) und „Wunschloses Unglück“ („Žalost onkraj sanj“, Beletrina, Ljubljana, 2020) – nahm Amalija Maček die Übersetzung seines komplexen und umfangreichen Romans „Mein Jahr in der Niemandsbucht“ („Moje leto v Nikogaršnjem zalivu“, Beletrina, 2021) in Angriff. Sie übersetzte ihn über viele Jahre hinweg äußerst geduldig und genau. Das Ergebnis ist ein übersetzerisches Meisterwerk. Es gibt nur wenige Übersetzungen, die so sehr auf das Original eingestimmt sind. Handkes aneinandergereihte, wellenförmige, manchmal widersprüchliche Satzstrukturen, die durch das Subjekt/den Beobachter/den Erzähler mal subtil, mal egozentrisch auch die Perspektiven anderer Personen herleiten, wurden von der Übersetzerin im Slowenischen sprachlich und syntaktisch perfekt nachgebildet, ohne dabei ihre logische Reihenfolge zu brechen oder die Aussagekraft zu verschleiern. Auch in Klang und Rhythmus gelang es ihr, den für Handke charakteristischen Erzählfluss nachzugestalten. Mit ihren – gemäß einer feinfühligen adaptierenden Strategie – Übersetzungsentscheidungen und ihrer Wortwahl entfaltet sie den ganzen Reichtum der slowenischen Sprache und zeigt auf, was in ihr sprachlich möglich ist. Dies ist nicht nur eine herausragende Leistung auf dem Gebiet der Übersetzung aus dem Deutschen, sondern auch ein Werk, das aus der gesamten in den letzten Jahren ins Slowenische übersetzten Literatur hervorsticht.
ÜBER DIE PREISTRÄGERIN
Amalija Maček wurde 1971 in Ljubljana geboren. Sie studierte Germanistik und Hispanistik an der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana und erwarb ihren Magister- und Doktortitel in deutscher Gegenwartsliteratur mit den Schwerpunkten Lyrik und Orientalistik. Ihr Studium setzte sie in Tübingen, Berlin, Leipzig und Granada fort. Sie wirkte an den europäischen Projekten EULITA, TRAFUT, TransStar Europa und TraiLLD mit. Seit 2008 ist sie akkreditierte Dolmetscherin für EU-Institutionen und koordiniert den Masterstudiengang Dolmetschen an der Abteilung für Übersetzen der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana, wo sie seit 2001 angestellt ist. Darüber hinaus ist sie Koordinatorin des universitären Programms zur beruflichen Weiterbildung von Gerichts- und Amtsdolmetschern und Mitglied des Verbandes slowenischer Literaturübersetzer (DSKP) sowie des slowenischen Konferenzdolmetscherverbandes (ZKTS). Für ihre literarischen Übersetzungen erhielt sie die Prämie der Kunstsektion des österreichischen Bundeskanzleramtes. Im Jahr 2021 war sie unter den drei Finalistinnen für den Preis Sovretova nagrada (jährlich vom DSKP verliehene Auszeichnung für herausragende Literaturübersetzungen).
Für die herausragende Übersetzung von „Chronos erntet“ ("Kronosova žetev" von Mojca Kumerdej), erschienen 2019 beim Wallstein Verlag, wird der Fabjan-Hafner-Preis für das Jahr 2020 nach der Beurteilung der Fachjury – in der folgenden Zusammensetzung: Jürgen Jakob Becker, Dr. Johann Georg Lughofer und Dominik Srienc – dem Übersetzer Dr. Erwin Köstler verliehen.
BEGRÜNDUNG DER JURY
Erwin Köstler übersetzte in mehr als 25 Jahren fast 50 Bücher, darunter bedeutendste Werke aus dem Slowenischen und hat sich dabei unter anderem als Herausgeber der deutschsprachigen kommentierten Werkausgabe Ivan Cankars im Drava Verlag höchstes Lob und Anerkennung verdient.
Nun stellte er sich erneut einer Riesenherausforderung: Das herausragende und preisgekrönte Werk von Mojca Kumerdej „Kronosova žetev“ war aufgrund seiner spannenden vielperspektivischen und vielschichtigen Sicht auf die Zeit der Gegenreformation in damals innerösterreichischen Landen, heute slowenischem Boden, zweifellos ein Muss für eine Übersetzung ins Deutsche. Skurrilerweise scheint es sogar, dass in Zeiten heutiger politischer Präferenzen der Wählenden, der vor Hysterie wegen Migrationsbewegungen und der Ängste vor Viren das in fernen Zeiten angesiedelte Werk nach seinem Erscheinen immer noch an Aktualität und Bedeutung gewinnt. Wir können nur dankbar sein, dass dieses wichtige Buch nun in deutscher Sprache vorliegt.
Doch nicht nur die Romanlänge, sondern auch die literarische Mehrstimmigkeit, die in diesem Text mit extrem verschiedenen sprachlichen Registern einhergeht, machte dieses Unternehmen zu einer äußerst schwierigen Aufgabe – sprachlich sowie inhaltlich. Diese große Herausforderung erledigte Erwin Köstler mit Bravour: die höchst anspruchsvollen Wechsel von umgangssprachlichen und konjunktivträchtigen Gerüchten im Volk zu laienphilosophischen Reflexionen, von kirchengeschichtlichen Berichten und Diskussionen zu Flüchen voller Kraftausdrücke, schafft der Übersetzer ohne jeglichen sprachlichen, inhaltlichen oder literarischen Fehlgriff, obwohl diese Übersetzungsarbeit diesbezüglich wohl ein Minenfeld war. Die vortreffliche Übersetzung zeugt nicht nur von äußerstem sprachlichen und sozialen Feingefühl, sondern auch von großem historischen und kulturellen Wissen.
ÜBER DEN PREISTRÄGER
Erwin Köstler, geboren 1964, ist Übersetzer und freier Literaturwissenschaftler. Er lebt in Wien. Köstler übersetzt aus allen literarischen Gattungen, sowohl „klassische“ (u.a. Vladimir Bartol, Ivan Cankar, Slavko Grum, Srečko Kosovel, Prežihov Voranc) als auch zeitgenössische slowenische Literatur (u.a. Franjo Frančič, Zoran Hočevar, Mojca Kumerdej, Sebastijan Pregelj, Andrej Skubic, Breda Smolnikar), Literatur von Kärntner Slowenen (Jože Blajs, Milka Hartman, Lipej Kolenik) und Graphic novels – zuletzt erschienen: "Alma M. Karlin, Weltbürgerin aus der Provinz" von Marijan Pušavec und Jakob Klemenčic; 2018 erscheint ferner die fünfbändige Graphic novel „Die Mexikaner“ von Zoran Smiljanić und Marijan Pušavec in seiner Übersetzung (beide: bahoe books, Wien). Er arbeitete mehr als zwei Jahrzehnte intensiv mit dem Klagenfurter Drava Verlag zusammen und startete 1994 dort seine Werkausgabe Ivan Cankar in kommentierten Einzelbänden, die seinen Ruf als literarischer Übersetzer und innovativer Literaturvermittler begründete. Er war Initiator und Herausgeber der Buchreihe "Slowenische Bibliothek", die als Gemeinschaftsprojekt der Verlage Drava, Hermagoras/Mohorjeva und Wieser geplant war und von welcher er 2013 fünf Bände realisieren konnte. Seine umfangreiche Vermittlungstätigkeit schließt Vorträge und Lehrtätigkeit ebenso ein wie publizistische und wissenschaftliche Arbeiten zum Übersetzen und zur slowenischen Literatur. 1999 wurde Köstler mit dem Österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzer ausgezeichnet, 2010 erhielt er das Lavrin-Diplom des slowenischen Übersetzerverbandes.
BEGRÜNDUNG DER JURY
Erwin Köstler übersetzte in mehr als 25 Jahren fast 50 Bücher, darunter bedeutendste Werke aus dem Slowenischen und hat sich dabei unter anderem als Herausgeber der deutschsprachigen kommentierten Werkausgabe Ivan Cankars im Drava Verlag höchstes Lob und Anerkennung verdient.
Nun stellte er sich erneut einer Riesenherausforderung: Das herausragende und preisgekrönte Werk von Mojca Kumerdej „Kronosova žetev“ war aufgrund seiner spannenden vielperspektivischen und vielschichtigen Sicht auf die Zeit der Gegenreformation in damals innerösterreichischen Landen, heute slowenischem Boden, zweifellos ein Muss für eine Übersetzung ins Deutsche. Skurrilerweise scheint es sogar, dass in Zeiten heutiger politischer Präferenzen der Wählenden, der vor Hysterie wegen Migrationsbewegungen und der Ängste vor Viren das in fernen Zeiten angesiedelte Werk nach seinem Erscheinen immer noch an Aktualität und Bedeutung gewinnt. Wir können nur dankbar sein, dass dieses wichtige Buch nun in deutscher Sprache vorliegt.
Doch nicht nur die Romanlänge, sondern auch die literarische Mehrstimmigkeit, die in diesem Text mit extrem verschiedenen sprachlichen Registern einhergeht, machte dieses Unternehmen zu einer äußerst schwierigen Aufgabe – sprachlich sowie inhaltlich. Diese große Herausforderung erledigte Erwin Köstler mit Bravour: die höchst anspruchsvollen Wechsel von umgangssprachlichen und konjunktivträchtigen Gerüchten im Volk zu laienphilosophischen Reflexionen, von kirchengeschichtlichen Berichten und Diskussionen zu Flüchen voller Kraftausdrücke, schafft der Übersetzer ohne jeglichen sprachlichen, inhaltlichen oder literarischen Fehlgriff, obwohl diese Übersetzungsarbeit diesbezüglich wohl ein Minenfeld war. Die vortreffliche Übersetzung zeugt nicht nur von äußerstem sprachlichen und sozialen Feingefühl, sondern auch von großem historischen und kulturellen Wissen.
ÜBER DEN PREISTRÄGER
Erwin Köstler, geboren 1964, ist Übersetzer und freier Literaturwissenschaftler. Er lebt in Wien. Köstler übersetzt aus allen literarischen Gattungen, sowohl „klassische“ (u.a. Vladimir Bartol, Ivan Cankar, Slavko Grum, Srečko Kosovel, Prežihov Voranc) als auch zeitgenössische slowenische Literatur (u.a. Franjo Frančič, Zoran Hočevar, Mojca Kumerdej, Sebastijan Pregelj, Andrej Skubic, Breda Smolnikar), Literatur von Kärntner Slowenen (Jože Blajs, Milka Hartman, Lipej Kolenik) und Graphic novels – zuletzt erschienen: "Alma M. Karlin, Weltbürgerin aus der Provinz" von Marijan Pušavec und Jakob Klemenčic; 2018 erscheint ferner die fünfbändige Graphic novel „Die Mexikaner“ von Zoran Smiljanić und Marijan Pušavec in seiner Übersetzung (beide: bahoe books, Wien). Er arbeitete mehr als zwei Jahrzehnte intensiv mit dem Klagenfurter Drava Verlag zusammen und startete 1994 dort seine Werkausgabe Ivan Cankar in kommentierten Einzelbänden, die seinen Ruf als literarischer Übersetzer und innovativer Literaturvermittler begründete. Er war Initiator und Herausgeber der Buchreihe "Slowenische Bibliothek", die als Gemeinschaftsprojekt der Verlage Drava, Hermagoras/Mohorjeva und Wieser geplant war und von welcher er 2013 fünf Bände realisieren konnte. Seine umfangreiche Vermittlungstätigkeit schließt Vorträge und Lehrtätigkeit ebenso ein wie publizistische und wissenschaftliche Arbeiten zum Übersetzen und zur slowenischen Literatur. 1999 wurde Köstler mit dem Österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzer ausgezeichnet, 2010 erhielt er das Lavrin-Diplom des slowenischen Übersetzerverbandes.
Für die hervorragende Übersetzung „Kaj se pravi misliti?“ („Was heißt Denken?“ von Martin Heidegger), erschienen 2017 beim wissenschaftlichen Verlag der Philosophischen Fakultät Ljubljana (Znanstvena založba Filozofske fakultete), wird der Fabjan-Hafner-Preis für 2019 nach der Beurteilung der Fachjury, in der folgenden Zusammenstellung: Brane Čop, Prof. Dr. Irena Samide und Prof. Dr. Tanja Žigon dem Übersetzer Dr. Aleš Košar verliehen.
BEGRÜNDUNG DER JURY
Dr. Aleš Košar, der an der Abteilung für Philosophie der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana im Jahre 2010 mit der Doktorarbeit „Filozofsko-teoretske in kulturno-zgodovinske osnove Heideggrove obravnave izvora umetniškega dela“, (Philosophisch-theoretische und kultur-geschichtliche Grundlagen von Heideggers Behandlung des Ursprungs des Kunstwerks) promovierte, ist ein anerkannter Übersetzer wissenschaftlicher Werke aus den Gebieten der Phänomenologie, der deutschen klassischen Philosophie und Romantik.
In seiner Übersetzung des Werks „Was heißt Denken?“ von Martin Heidegger, das unter dem Titel „Kaj se pravi misliti?“ 2017 bei der Znanstvena založba Filozofske fakultete erschienen ist, nimmt sich Košar Heideggers Vorlesungen aus 1951 und 1952 vor, in denen der deutsche Philosoph grundlegende seinsgeschichtliche doppelgleisige Bedenken darzulegen versucht, welche aus dem Gedachten – bei Košar mislenje“ - hervorgehen – was heißt Denken in der Tat und was erlegt das Gedachte in historischer Sicht dem Menschen auf ?
In seiner Übersetzung, durchwoben von leidenschaftlichem Verdeutlichungsdrang und sprachlichem Mut spielt Košar alle übersetzerische Register, die ihm zur Verfügung stehen, durch, und mehr noch: er lässt sich von alten Quellen inspirieren, wie den Freisinger Denkmälern, bereichert den slowenischen Ausdruck mit sprachlichen und gedanklichen Innovationen und meidet gewandt die Gefahr, der Suche nach grundlegenden Wahrheiten oder einer Philosophie, „die es besser weiß“, zu verfallen. Sein übersetzerisches Meisterwerk stellt terminologische Grundlagen für das Übertragen von Heideggers Werk ins Slowenische auf, und zwar wie von Dean Komel in seinem Begleitwort verdeutlicht: „dass dabei die Bedeutungsmöglichkeiten der deutschen Artikulation hervortreten. Die slowenische 'Nach'artikulierung steht hier nicht nur stellvertretend für die Deutsche, sondern tritt selbstständig und parallel als sinnvolle Wortwerdung auf, die eher ausdrückt denn abdruckt, was das Original vermittelt – genau wie die Übersetzung selber.“
Auf jeder Seite sticht die Intention des Übertragenden ins Auge, nichtsdestotrotz muss man den Namen des Übersetzers im Buch, dem Umschlag, der Titelseite mit scharfem Auge nachgerade suchen, wenn wir noch die verlegerische Praxis mit einer Randnotiz streifen.
Košars eigenständige Wortwelt strahlt überbordende Kreativität wider, dabei wird aber jedes Syntagma, jeder Gedanke, jede übersetzerische Nuss mit beinahe forensischer Genauigkeit angegangen. Wir haben es hier mit einer Über-Setzung, einzigartiger philosophischer Redeweise zu tun.
ÜBER DEN PREISTRÄGER
Aleš Košar wurde 1964 in Celje geboren und besuchte die Grund- und die Mittelschule in Ljubljana. Nach dem Abitur am Gymnasium Vič 1982 und der Absolvierung der Wehrpflicht (1983/84) begann er das Studium der Philosophie und vergleichenden Literaturwissenschaft an der Philosophischen Fakultät Ljubljana. Während des Studiums vervollkommnete er seine Deutschkenntnisse am Goethe-Institut (1987/88) und studierte an der Universität Wien (1991/92). Er begann für Slovenska matica, Nova revija, Phainomena, revija AB, Apokalipsa, Literatura, Philosophie als Abiturgegenstand, den Verlag Hyperion, ZRC SAZU, ZI FF (Wissenschaftliche Institute der Slow. Akademie für Wissenschaft und Kunst sowie der Philosophischen Fakultät), Traugott-Bautz und Königshausen & Neumann zu übersetzen. Seine Diplomarbeit war dem späten Hölderlin gewidmet („V ljubki modrini“, 2002), seine Doktorarbeit Heidegger: „Philosophisch-theoretische und kultur-geschichtliche Grundlagen von Heideggers Behandlung des Ursprungs des Kunstwerks“ (2010). Im darauffolgenden März verlieh ihm das Ministerium für Kultur der Republik Slowenien den Status eines selbstständigen Übersetzers auf den Gebieten Literatur und Humanistik sowie 2014 eine Erweiterung des Status. Košar widmet sich der Übersetzung wissenschaftlicher Werke aus den Gebieten der Phänomenologie, der deutschen klassischen Philosophie und Romantik.
BEGRÜNDUNG DER JURY
Dr. Aleš Košar, der an der Abteilung für Philosophie der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana im Jahre 2010 mit der Doktorarbeit „Filozofsko-teoretske in kulturno-zgodovinske osnove Heideggrove obravnave izvora umetniškega dela“, (Philosophisch-theoretische und kultur-geschichtliche Grundlagen von Heideggers Behandlung des Ursprungs des Kunstwerks) promovierte, ist ein anerkannter Übersetzer wissenschaftlicher Werke aus den Gebieten der Phänomenologie, der deutschen klassischen Philosophie und Romantik.
In seiner Übersetzung des Werks „Was heißt Denken?“ von Martin Heidegger, das unter dem Titel „Kaj se pravi misliti?“ 2017 bei der Znanstvena založba Filozofske fakultete erschienen ist, nimmt sich Košar Heideggers Vorlesungen aus 1951 und 1952 vor, in denen der deutsche Philosoph grundlegende seinsgeschichtliche doppelgleisige Bedenken darzulegen versucht, welche aus dem Gedachten – bei Košar mislenje“ - hervorgehen – was heißt Denken in der Tat und was erlegt das Gedachte in historischer Sicht dem Menschen auf ?
In seiner Übersetzung, durchwoben von leidenschaftlichem Verdeutlichungsdrang und sprachlichem Mut spielt Košar alle übersetzerische Register, die ihm zur Verfügung stehen, durch, und mehr noch: er lässt sich von alten Quellen inspirieren, wie den Freisinger Denkmälern, bereichert den slowenischen Ausdruck mit sprachlichen und gedanklichen Innovationen und meidet gewandt die Gefahr, der Suche nach grundlegenden Wahrheiten oder einer Philosophie, „die es besser weiß“, zu verfallen. Sein übersetzerisches Meisterwerk stellt terminologische Grundlagen für das Übertragen von Heideggers Werk ins Slowenische auf, und zwar wie von Dean Komel in seinem Begleitwort verdeutlicht: „dass dabei die Bedeutungsmöglichkeiten der deutschen Artikulation hervortreten. Die slowenische 'Nach'artikulierung steht hier nicht nur stellvertretend für die Deutsche, sondern tritt selbstständig und parallel als sinnvolle Wortwerdung auf, die eher ausdrückt denn abdruckt, was das Original vermittelt – genau wie die Übersetzung selber.“
Auf jeder Seite sticht die Intention des Übertragenden ins Auge, nichtsdestotrotz muss man den Namen des Übersetzers im Buch, dem Umschlag, der Titelseite mit scharfem Auge nachgerade suchen, wenn wir noch die verlegerische Praxis mit einer Randnotiz streifen.
Košars eigenständige Wortwelt strahlt überbordende Kreativität wider, dabei wird aber jedes Syntagma, jeder Gedanke, jede übersetzerische Nuss mit beinahe forensischer Genauigkeit angegangen. Wir haben es hier mit einer Über-Setzung, einzigartiger philosophischer Redeweise zu tun.
ÜBER DEN PREISTRÄGER
Aleš Košar wurde 1964 in Celje geboren und besuchte die Grund- und die Mittelschule in Ljubljana. Nach dem Abitur am Gymnasium Vič 1982 und der Absolvierung der Wehrpflicht (1983/84) begann er das Studium der Philosophie und vergleichenden Literaturwissenschaft an der Philosophischen Fakultät Ljubljana. Während des Studiums vervollkommnete er seine Deutschkenntnisse am Goethe-Institut (1987/88) und studierte an der Universität Wien (1991/92). Er begann für Slovenska matica, Nova revija, Phainomena, revija AB, Apokalipsa, Literatura, Philosophie als Abiturgegenstand, den Verlag Hyperion, ZRC SAZU, ZI FF (Wissenschaftliche Institute der Slow. Akademie für Wissenschaft und Kunst sowie der Philosophischen Fakultät), Traugott-Bautz und Königshausen & Neumann zu übersetzen. Seine Diplomarbeit war dem späten Hölderlin gewidmet („V ljubki modrini“, 2002), seine Doktorarbeit Heidegger: „Philosophisch-theoretische und kultur-geschichtliche Grundlagen von Heideggers Behandlung des Ursprungs des Kunstwerks“ (2010). Im darauffolgenden März verlieh ihm das Ministerium für Kultur der Republik Slowenien den Status eines selbstständigen Übersetzers auf den Gebieten Literatur und Humanistik sowie 2014 eine Erweiterung des Status. Košar widmet sich der Übersetzung wissenschaftlicher Werke aus den Gebieten der Phänomenologie, der deutschen klassischen Philosophie und Romantik.
2018 wurde der Preis für eine herausragende Übersetzung aus dem Slowenischen ins Deutsche an den Übersetzer Johann Strutz für die Übersetzung des Buchs „Seelenruhig“ von Florjan Lipuš („Mirne duše“, Jung und Jung Verlag, 2017) ins Deutsche verliehen. Die lobende Erwähnung ging an Dr. Erwin Köstler für seine hervorragende Übertragung des aufrührenden Romans „Ruhe“ (Drava, 2017) von Andrej E. Skubic. Die Preisverleihung fand am 16.03.2018 auf der Leipziger Buchmesse statt.
Jury: Dr. Andrea Leskovec, Dr. Andreas Leben, Dr. Jörg Plath.
BEGRÜNDUNG DER JURY
„Seelenruhig“ (Jung und Jung Verlag) ist die fünfte Übersetzung eines Prosatextes von Florjan Lipuš durch Johann Strutz. Lipuš versammelt darin noch einmal alle Themen seines Lebens und Schreibens im Gestus einer rhythmisch sich vollziehenden Erinnerung und Vergegenwärtigung. Die Vergangenheit ist mythisch gefärbt, sie ist älter als der sich erinnernde Mensch, und genauso wie die Vorzeit übersteigt ihn die Gegenwart: Scheiterhaufen züngeln im KZ, eine „Tödin“ dengelt auf dem Hofplatz und Blitze fahren dem älteren Erzähler morgens nach dem Erwachen aus den Fingernägeln.
Wie leicht hätte dieses große Prosapoem nach der Übertragung raunend altbacken wirken können! Dank Johann Strutz besitzt es im Deutschen einen poetischen Ton, der höchst persönlich und dringlich alle Zeiten und Wortschichten durchdringt. Strutz lässt die liturgischen Elemente in der Lebensvergewisserung des ehemaligen Internatsschülers und Priesterseminaristen an-, aber nicht katholisch klingen. Mühelos verschmilzt er Archaisches mit Modernem und weiß vom „moosbewachsenen Stein“ ebenso viel wie von körperlichen Beschwerden, von „durchgescheuerter Alltäglichkeit“ ebenso viel wie von der Liebe. Johann Strutz hat für dieses schmale, kräftige und zärtliche Buch einen sanft lyrischen Ton gefunden, der das Deutsche bereichert und die poetische Sprache des Originals spürbar werden lässt.
LOBENDE ERWÄHNUNG
Dr. Erwin Köstler für die hervorragende Übertragung des aufrührenden Romans Ruhe (Drava, 2017) von Andrej E. Skubic.
ÜBER DEN PREISTRÄGER
Dr. Johann Strutz ist an den Universitäten in Nova Gorica, Koper und Klagenfurt in den Bereichen Kultur- und Erzähltheorie, Literatur und Mehrsprachigkeit, Semiotik, Beziehungen zwischen den italienischen, österreichischen und südslawischen Literaturen und kleinen Literaturen im europäischen Kontext tätig. 1977 promovierte er und arbeitete in verschiedenen Bereichen an den Universitäten in Graz und Klagenfurt. 2005 Habilitation: „Regionalität und Interkulturalität. Prolegomena zu einer literarischen Komparatistik der Alpen-Adria-Region“. Er übersetzt literarische und wissenschaftliche Texte aus dem Englischen und Walisischen sowie aus den Sprachen des Klagenfurter komparatistischen Regionalschwerpunkts (Italienisch, Kroatisch, Serbisch, Slowenisch). Seine Arbeit wurde mit diversen Preisen ausgezeichnet: Hermann-Lenz-Preis für literarische Übersetzung 2006, Österreichischer Staatspreis für literarische Übersetzung 2010, Würdigungspreis für Geistes- und Sozialwissenschaften 2016.
Jury: Dr. Andrea Leskovec, Dr. Andreas Leben, Dr. Jörg Plath.
BEGRÜNDUNG DER JURY
„Seelenruhig“ (Jung und Jung Verlag) ist die fünfte Übersetzung eines Prosatextes von Florjan Lipuš durch Johann Strutz. Lipuš versammelt darin noch einmal alle Themen seines Lebens und Schreibens im Gestus einer rhythmisch sich vollziehenden Erinnerung und Vergegenwärtigung. Die Vergangenheit ist mythisch gefärbt, sie ist älter als der sich erinnernde Mensch, und genauso wie die Vorzeit übersteigt ihn die Gegenwart: Scheiterhaufen züngeln im KZ, eine „Tödin“ dengelt auf dem Hofplatz und Blitze fahren dem älteren Erzähler morgens nach dem Erwachen aus den Fingernägeln.
Wie leicht hätte dieses große Prosapoem nach der Übertragung raunend altbacken wirken können! Dank Johann Strutz besitzt es im Deutschen einen poetischen Ton, der höchst persönlich und dringlich alle Zeiten und Wortschichten durchdringt. Strutz lässt die liturgischen Elemente in der Lebensvergewisserung des ehemaligen Internatsschülers und Priesterseminaristen an-, aber nicht katholisch klingen. Mühelos verschmilzt er Archaisches mit Modernem und weiß vom „moosbewachsenen Stein“ ebenso viel wie von körperlichen Beschwerden, von „durchgescheuerter Alltäglichkeit“ ebenso viel wie von der Liebe. Johann Strutz hat für dieses schmale, kräftige und zärtliche Buch einen sanft lyrischen Ton gefunden, der das Deutsche bereichert und die poetische Sprache des Originals spürbar werden lässt.
LOBENDE ERWÄHNUNG
Dr. Erwin Köstler für die hervorragende Übertragung des aufrührenden Romans Ruhe (Drava, 2017) von Andrej E. Skubic.
ÜBER DEN PREISTRÄGER
Dr. Johann Strutz ist an den Universitäten in Nova Gorica, Koper und Klagenfurt in den Bereichen Kultur- und Erzähltheorie, Literatur und Mehrsprachigkeit, Semiotik, Beziehungen zwischen den italienischen, österreichischen und südslawischen Literaturen und kleinen Literaturen im europäischen Kontext tätig. 1977 promovierte er und arbeitete in verschiedenen Bereichen an den Universitäten in Graz und Klagenfurt. 2005 Habilitation: „Regionalität und Interkulturalität. Prolegomena zu einer literarischen Komparatistik der Alpen-Adria-Region“. Er übersetzt literarische und wissenschaftliche Texte aus dem Englischen und Walisischen sowie aus den Sprachen des Klagenfurter komparatistischen Regionalschwerpunkts (Italienisch, Kroatisch, Serbisch, Slowenisch). Seine Arbeit wurde mit diversen Preisen ausgezeichnet: Hermann-Lenz-Preis für literarische Übersetzung 2006, Österreichischer Staatspreis für literarische Übersetzung 2010, Würdigungspreis für Geistes- und Sozialwissenschaften 2016.
2017 wurde der Preis erstmalig für eine herausragende Übersetzung aus dem Deutschen ins Slowenische an den slowenischen Übersetzer Štefan Vevar für die Übersetzung des Romans „Die Ringe des Saturn“ von Winfried Georg Sebald („Saturnovi prstani“, Verlag Beletrina, 2016) ins Slowenische verliehen. Die lobende Erwähnung ging an Andrej Medved für seine hervorragende Übertragung der ausgewählten Gedichte von Hans Arp („Dada in druge pesmi“, Mladinska knjiga, 2016).
Jury: Dr. Špela Virant, Dr. Vesna Kondrič Horvat, Alenka Vesenjak.
BEGRÜNDUNG DER JURY
Der Übersetzer Štefan Vevar, der bereits zwei andere Werke von Sebald („Die Ausgewanderten und Austerlitz“) ins Slowenische übertragen hat, überzeugte durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Buch „Die Ringe des Saturn“. Die Vorstellung des Lesers vom Wandern an der englischen Ostküste (nämlich der rote Faden des Buches) lässt ihn so lange entspannen und schwärmen, bis er den Roman „Die Ringe des Saturn“ aufschlägt.
Sebald und sein treuster Reisebegleiter, Štefan Vevar, begleiten den Leser in eine komplexe, vielschichtige Welt, in der alles sprudelt, eine Bedeutung hat und nichts überflüssig ist. Vevar gelingt es, den für Sebald typischen „meditativen Stil“ überzeugend herauszuarbeiten – dabei verdeutlicht er die Vielschichtigkeit der Assoziationsketten, die Epochen und Menschen darstellen und uns klar machen, dass nichts so ist, wie es erscheint.
„Die Ringe des Saturn“ sind in Vevars Übersetzung alles andere als verträumt; sie halten den Leser stets in voller Bereitschaft auf eine neue Episode dieses eigenartigen, vertieften Reiseberichtes, der an den richtigen Stellen mit sanfter Ironie aufgelockert ist.
Vevars herausragende Übersetzung des Buchs „Die Ringe des Saturn“ von Sebald verzaubert den Leser so sehr, dass er selbst am liebsten an die verödete britische Küste gehen würde und durch das Fenster einer Küstenkneipe betrachten würde, wie der Tag langsam vorbei geht. Ein Tag, der aus dramatischen Jahrhunderten gewachsen ist.
LOBENDE ERWÄHNUNG
Die lobende Erwähnung geht an Andrej Medved für seine Übersetzung der ausgewählten Gedichte von Hans Arp. Mit seiner ausgezeichneten Übertragung der Sammlung „Dada und andere Gedichte“ (Mladinska knjiga, 2016), die Arps Poesie den slowenischen Lesern öffnet, hat Arp mit seiner weitgehend unbekannten Dichtkunst eine angemessene Würdigung erfahren.
ÜBER DEN PREISTRÄGER
Dr. Štefan Vevar, Germanist und Anglist, Übersetzer aus dem Deutschen mit Schwerpunkt auf die Klassiker der deutschen Literatur, Übersetzungswissenschaftler und Theaterhistoriker. 1999 Magisterarbeit „Grundaspekte und -prinzipien der Theorie literarischer Übersetzung“ (2001 erschienen beim Verlag Beletrina) und 2011 Promotion zum Thema „Das Phänomen Goethe. Seine Ästhetik und Poetik zwischen dem Original und der slowenischen Übersetzung“ (2012 erschienen beim Verlag Literatura). Vevars Bibliographie der Übersetzungen beginnt in der deutschen Klassik (Goethe und Schiller), geht über die Romantik (ausgewählte Werke von Novalis und Gedichte von Heine), den biedermeierischen Realismus („Der Nachsommer“ von Adalbert Stifter), Realismus von Theodor Fontane („Frau Jenny Treibel“), bis hin zum Modernismus von Robert Musil („Drei Frauen“), Hermann Broch („Die Schlafwandler“) und Franz Kafka (gesamte Kurzprosa in 4 Bänden). Außerdem übersetzt er auch die größten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und Gegenwartsliteratur, unter anderem Christoph Ransmayr, Friedrich Dürrenmatt, Heiner Müller, Jurek Becker, Günter Grass, Erich Fried, W. G. Sebald, Sten Nadolny, Arno Geiger, Thomas Bernhard, Maja Haderlap, Peter Handke, Lutz Seiler u.A. Er arbeitet am Slowenischen Theaterinstitut, wo er auch mehrere Artikel und Publikationen zur slowenischen Theatergeschichte veröffentlicht hat. 2013 publizierte er seine Monographie Die Seiltanz-Kunst des Übersetzens. Für seine Übersetzung des Buchs Wilhelm Meisters Lehrjahre von Goethe erhielt er 1999 den Sovre Preis.
Jury: Dr. Špela Virant, Dr. Vesna Kondrič Horvat, Alenka Vesenjak.
BEGRÜNDUNG DER JURY
Der Übersetzer Štefan Vevar, der bereits zwei andere Werke von Sebald („Die Ausgewanderten und Austerlitz“) ins Slowenische übertragen hat, überzeugte durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Buch „Die Ringe des Saturn“. Die Vorstellung des Lesers vom Wandern an der englischen Ostküste (nämlich der rote Faden des Buches) lässt ihn so lange entspannen und schwärmen, bis er den Roman „Die Ringe des Saturn“ aufschlägt.
Sebald und sein treuster Reisebegleiter, Štefan Vevar, begleiten den Leser in eine komplexe, vielschichtige Welt, in der alles sprudelt, eine Bedeutung hat und nichts überflüssig ist. Vevar gelingt es, den für Sebald typischen „meditativen Stil“ überzeugend herauszuarbeiten – dabei verdeutlicht er die Vielschichtigkeit der Assoziationsketten, die Epochen und Menschen darstellen und uns klar machen, dass nichts so ist, wie es erscheint.
„Die Ringe des Saturn“ sind in Vevars Übersetzung alles andere als verträumt; sie halten den Leser stets in voller Bereitschaft auf eine neue Episode dieses eigenartigen, vertieften Reiseberichtes, der an den richtigen Stellen mit sanfter Ironie aufgelockert ist.
Vevars herausragende Übersetzung des Buchs „Die Ringe des Saturn“ von Sebald verzaubert den Leser so sehr, dass er selbst am liebsten an die verödete britische Küste gehen würde und durch das Fenster einer Küstenkneipe betrachten würde, wie der Tag langsam vorbei geht. Ein Tag, der aus dramatischen Jahrhunderten gewachsen ist.
LOBENDE ERWÄHNUNG
Die lobende Erwähnung geht an Andrej Medved für seine Übersetzung der ausgewählten Gedichte von Hans Arp. Mit seiner ausgezeichneten Übertragung der Sammlung „Dada und andere Gedichte“ (Mladinska knjiga, 2016), die Arps Poesie den slowenischen Lesern öffnet, hat Arp mit seiner weitgehend unbekannten Dichtkunst eine angemessene Würdigung erfahren.
ÜBER DEN PREISTRÄGER
Dr. Štefan Vevar, Germanist und Anglist, Übersetzer aus dem Deutschen mit Schwerpunkt auf die Klassiker der deutschen Literatur, Übersetzungswissenschaftler und Theaterhistoriker. 1999 Magisterarbeit „Grundaspekte und -prinzipien der Theorie literarischer Übersetzung“ (2001 erschienen beim Verlag Beletrina) und 2011 Promotion zum Thema „Das Phänomen Goethe. Seine Ästhetik und Poetik zwischen dem Original und der slowenischen Übersetzung“ (2012 erschienen beim Verlag Literatura). Vevars Bibliographie der Übersetzungen beginnt in der deutschen Klassik (Goethe und Schiller), geht über die Romantik (ausgewählte Werke von Novalis und Gedichte von Heine), den biedermeierischen Realismus („Der Nachsommer“ von Adalbert Stifter), Realismus von Theodor Fontane („Frau Jenny Treibel“), bis hin zum Modernismus von Robert Musil („Drei Frauen“), Hermann Broch („Die Schlafwandler“) und Franz Kafka (gesamte Kurzprosa in 4 Bänden). Außerdem übersetzt er auch die größten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und Gegenwartsliteratur, unter anderem Christoph Ransmayr, Friedrich Dürrenmatt, Heiner Müller, Jurek Becker, Günter Grass, Erich Fried, W. G. Sebald, Sten Nadolny, Arno Geiger, Thomas Bernhard, Maja Haderlap, Peter Handke, Lutz Seiler u.A. Er arbeitet am Slowenischen Theaterinstitut, wo er auch mehrere Artikel und Publikationen zur slowenischen Theatergeschichte veröffentlicht hat. 2013 publizierte er seine Monographie Die Seiltanz-Kunst des Übersetzens. Für seine Übersetzung des Buchs Wilhelm Meisters Lehrjahre von Goethe erhielt er 1999 den Sovre Preis.