„Der Zauberberg”, oder eine Gaukelei will er sich machen
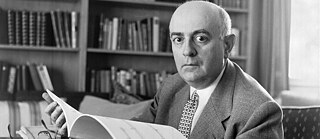
Für Thomas Mann war Theodor Adorno als Arnold-Schönberg-Forscher von Bedeutung. Letzterer postulierte 1962 sinngemäß, beim Mannschen Werk setze das wahre Verständnis erst ein, wenn man nicht mehr nach dem Baedeker schiele, und empfahl dem Leser des Zauberbergs, mühseliges Dechiffrieren der Symbolik bzw. das Nachvollziehen jener philosophischen Einflüsse, welche die Autorenabsicht darlegen würden, zu unterlassen. Stattdessen solle man den Roman einer dreifachen Musterung unterziehen und den Autor dabei hintanstellen, und genauso was er damit sagen wolle oder im Inhalt deponiert worden sei. Warum auf diesen Vorschlag eingehen, der heutzutage als intellektuelle – sagen wir - Schöngeisterei daherkommt? Wozu die Empfehlung zur wiederholten Lektüre eines Romans, der nicht nur mit Sekundärliteratur überfrachtet, sondern auch durch nachgewiesene mannigfache Leserfrustration vorbelastet ist? Und kann man überhaupt den Anmerkungen eines derart fordernden Philosophen, wie dem Autor der Negativen Dialektik, trauen?
Von Katarzyna Trzeciak
Laut Adorno beginne - Thomas Mann zum Trotz - das Werk da, wo die Absicht des Autors endet. Bloß hielt der 1939 in Princeton eine Vorlesung als Einführung in den Zauberberg, wo es heißt, das Werk habe eine immanente, bedeutend weitreichender Absicht, als jene des Autors selbst. Somit denkt er durchaus über Kunst so, wie sein intellektueller Partner, welcher in seinem Essay die Literatur vom konkreten Autor befreien wollte. Es gibt übrigens mehrere spezifische Ähnlichkeiten, da sich Adorno in seinem Großwerk Ästhetische Theorie mehrfach auf Mann bezieht, dessen Kunst er als „höheren Jux“ sieht. Adorno zitiert dabei nicht genau, gibt keine Quelle an und bezieht sich so direkt wie äquilibristisch auf Mann, da ihn schlussendlich das Ideal des Zirkuskünstlers interessiert, der Kunst als „Zauberkunststück“ erschafft: „auf dem obersten Formniveau wiederholt sich der verachtete Zirkusakt“. Ähnlich hält es Mann mit dem Zitieren von Autoritäten, wenn er seinen amerikanischen Hörern den Kern des Zauberbergs offenbart. Er beruft sich dabei auf Goethes „sehr ernsten Scherz [...]“, wie dieser dereinst seinen Faust beschrieben und Mann den Zauberberg angelegt hat. Schließlich maßt sich dieser da, wo Adorno zur dreifachen Lektüre bzw. dazu aufruft, den Autor hintan zu stellen, an, aufgrund der besonderen Romantechnik und ihrer musikalischen Komposition, eine zweifache Lektüre einzumahnen - aus genau jenem Grund, den zu vernachlässigen Adorno geraten hat. Beide Denker sind über eine Art Gauklerkunststück im Spiel von Unterschieden und unerwarteten Ähnlichkeiten verwandt; einem eigenen Humor der dort zu Tage tritt, wo Rezeptions- und zu einem gewissen Grad Literaturgeschichte oder auch Philosophie einzig Ernsthaftigkeit, und die Schwere des intellektuellen sowie literarischen Ouevres sehen heißen.
Und was, wenn man den Zauberberg als Jux und tollkühnes Gauklerstück sehen will? Placet experiri, wie Settembrini mit Petraca zu sagen pflegt. Damit steckt er Hans Castorp an, worauf der unbedarfte Held den Leitspruch in einer Situation anwendet, die seinem geistigen und geistlichen Mentor zutiefst widerstreben muss: Im Kapitel Fragwürdigstes nimmt er, von einer „unverantwortlichen Neugier des Bildungsreisenden“ geleitet, an einem spiritistischen Experiment teil. Placet experiri – es ist den Versuch wert. Die Protagonistin dieses Versuchs ist die junge Ellen Brand, ein „liebes Ding von neunzehn Jahren“, wie der Erzähler prätentiös verrät. Das Mädchen hat Talent als Medium, wodurch das „spiritistische Gesellschaftsspiel“ im vertrauten Zirkel, zu dem Hans Castorp stößt, ermöglicht wird. Thomas Mann staffiert das „Spiel“ mit dem sattsam bekannten Equipment: Es gibt Gläserrücken zur Kommunikation mit dem buchstabierenden Geist und schließlich nimmt auch Castorp Kontakt auf, um herauszufinden, wie lange sein Aufenthalt im Sanatorium noch dauern würde. Als Antwort erhält er den raunenden Befehl: „Geh […] quer!“, der nicht nur in ihm, sondern der gesamten anwesenden Gesellschaft keine geringe Bestürzung hervorruft. Und wäre das noch nicht genug, taucht auch noch ein „Souvenir“ auf seinen Knien liegend auf, das er nicht zur Seance mitgenommen hat und ihn demnach zutiefst verwundert. Castorp kann die kleine Glasplattten-Aufnahme jedoch schnell verbergen. Was also ist ihm da widerfahren? Als er Settembrini von der Seance berichtet, ist sein Mentor empört - über den Betrug. Doch verrät die indirekte Rede dieser Passage, dass Castorp mit einer derartigen Auflösung nicht einverstanden ist. Bei dieser Gelegenheit – der versuchten spiritistischen Sitzung – nämlich erkennt er für sich die Bedeutung des Begriffs „Gaukelei“: „Wie Herr Settembrini über das Wort »Gaukelei« denke, diesen Begriff, in welchem Elemente des Traumes und solche der Realität eine Mischung eingingen, die der Natur vielleicht weniger fremd sei, als unserem derben Tagesdenken. Das Geheimnis des Lebens sei buchstäblich bodenlos, und was Wunder denn, wenn gelegentlich Gaukeleien daraus aufstiegen, die – und so fort in unseres Helden freundlich zugeständlicher und reichlich laxer Art ...”. Diese Erwägungen über eine etwaige „Gaukelei“ werden in der Erzählung mit der autorentypischen Nachsicht gegenüber einer etwaigen Figurenentwicklung befriedet: Immer wenn Castorp auf eine höhere Bewusstseinsebene gelangen könnte, wird so eine Möglichkeit vom Autor sofort verworfen. Zauberkunststückchen und somit „Gaukeleien“ werden in der Erzählung als Jux höherer Ordnung gefasst und sind somit Verspottung von Erziehung oder Entwicklung des jungen Helden.
Man möchte glauben, das nüchterne Urteil Settembrinis, welches Castorp kurzfristig beeinflusst, würde den Status des Geschehenen entscheiden und dem Leser helfen, die spiritistische Sitzung einzuordnen. Doch nehmen in einem weiteren Aufzug dieses Kapitels, als Dr. Krokowski die Gabe von Ellen Brand nützt, einen noch seltsameren Verlauf: Diese nunmehr unter fachmännischer Überwachung eines Spezialisten und wissenschaftlich durchgeführte Seance endet für Castorp damit, dass er den Geist seines verstorbenen Cousins Joachim wahrnimmt und entschieden jenen Raum verlässt, in dem es zu einer wiederholten Störung der Realität gekommen ist. Darauf folgt unmittelbar das berühmte Kapitel Die große Gereiztheit in dem sich Naphta in einer Geste, die das intellektuelle Duell zwischen den beiden Castorpschen Mentoren krönt, das Leben nimmt. Es gibt demnach keine abschließende Erklärung über den Einfluss der spiritistischen Erfahrungen des Helden und es ist nichts über etwaige Folgen bekannt, welche der Anblick des toten Cousins hervorgerufen haben könnte. Schlussendlich bleibt auch unklar, wie Castorp demzufolge die „Gaukelei“ definieren würde. Würde er aufgebracht und zornig das Experiment des Dr. Krokowski als Betrug qualifizieren? Bliebe er dennoch bei seiner erweiterten Sicht des gauklerhaften Lebensgeheimnisses? Eines ist sicher: Jeglicher Versuch, im darauffolgenden Duell in die Auseinandersetzung einzugreifen, bleibt erfolglos. Er spielt darin keinerlei Rolle und das Aufeinandertreffen zweier Ideologien führt letzten Endes zum Tode eines Ideologen.
Placet experiri. Hans Castorp hat sich an der Teilnahme am Experiment versucht, jedoch – entgegen der Lesererwartung – verwehrt uns der Autor ein Ergebnis. Ist das Kapitel auch umfangreich und detailversessen, entwickelt es sich nicht so, dass es zu einer conclusio, somit geistigen und/oder intellektuellen Veränderung, respektive Reife, des Protagonisten führen würde. Das lateinische experientia, stammt vom Verb experior und bedeutet: „auf die Probe stellen“, was eher auf eine dauerhafte Tätigkeit denn Erkenntnis verweist. Und es ist nicht so, dass Hans Castorp es nicht probieren würde! Er macht seine Erfahrungen und bleibt dennoch die ganze Zeit über – vom Erzähler altvorderhaft vorgeführt - dasselbe kompromissheischende Subjekt.
In seiner Princetoner Vorlesung legte Mann dar, dass der Plot des Zauberbergs von Realität und der vita activa losgelöst bzw. der Roman selbst der Schwanengesang der Existenzform Sanatorium sei. In der Tat verändert sich der Held, der unerwartet sieben Jahre im internationalen Milieu des Sanatoriums „Berghof” verbringen muss, in keinster Weise. Trotzdem gewinnt man während der Lektüre den Eindruck, dass die Herausforderungen, Ereignisse, existenziellen und spiritistischen Versuche etwas bewirken, nützen oder zumindest irgendeinen Einfluss auf ihn hätten. Man erwartet einen Bildungs-irgendwas, bekommt aber unter dem Strich eine Thomas-Mannsche „Gaukelei“, eine Erzählung, die von Anfang an abgekartet ist, was aber, auf Grund der verarbeiteten Details und der Erzähltechnik, erst nach wiederholter Lektüre klar wird.
Bereits einleitend wird die perfekte „Mittelmäßigkeit“ des Hans Castorp unterstrichen („wenn wir das Wort „mittelmäßig“ zu seiner Kennzeichnung vermeiden, so [...] aus Achtung vor seinem Schicksal“), sodass er in ideologischer Hinsicht jeden extremen Standpunkt würde einnehmen können bzw. wahrscheinlich sämtliche Optionen in seinem staatsbürgerlichen Bewusstsein möglich wären, da er über deren Wert nicht zu urteilen vermag. Er ist ein unbeschriebenes Blatt, das wir letztlich lesen. Daher ist die Einführung zweier extrem unterschiedlicher Mentoren in diese fiktive Arena leichthin als Entwicklungspotential für eine wie auch immer gestaltete Bildung anzusehen. Thomas Mann aber lässt diese Chance verstreichen, wären ja ideologische Geplänkel mit fortschreitender Erzählung wenig zielführend. Eher dienen sie als nicht endenwollende Versuche, den Plot zu bremsen. Die seitens Naphta und Settembrini ausgebreiteten und entwickelten Ideen, aber auch die Dialoge unten den zahllosen Figuren selbst, ändern nichts am Ablauf der Geschichte, weil diese durch den Krieg, auf den keine der dargelegten Ideologien offenbar Einfluss hatte, abgebrochen wird. Der Roman setzt sich aus weltanschaulichen Wortgefechten, Diskussionen über die Grundlagen des Realen, aus möglichen Bildungserfahrungen sowie Umständen zusammen, die sich als völlig akausal erweisen. Vielmehr handelt es sich um endlose Versuche, die Romanhandlung anzuhalten. Auch auf der Erzählebene bilden die einzelnen Szenen über das Leben im Sanatorium keineswegs ein Ganzes: Im „Laufe der Jährchen“ werden dem Leser immer neue Aspekte im Mosaik des Systems als solches, die dem so häufig thematisierten divergenten Zeitsystem des Sanatoriums untergeordnet wurden, vorgesetzt. Der Roman über Ideen macht sich im Grunde über diese lustig, indem er deren Wirkungslosigkeit bloßstellt; ähnlich dem wirkungslosen Wunsch nach Entwicklung oder einem Bildungsfortschritt. Settembrini und Naphta übertrumpfen sich mit abstrakten Begriffen: „Logos“, „Gerechtigkeit“, „Wahrheit“ ... wodurch ihre Diskussionen von Anfang an nach Klischees, inhaltsleeren Zeichen tönen, bloß um die ihnen gewidmete Zeit zu füllen. Das ist die großartige Tücke von Mann, die zusätzlich durch die bereits vielfach angesprochene Zitiertechnik bzw. Manipulation durch Zitate seitens der Romanfiguren verstärkt wird. Małgorzata Łukasiewicz hat diese Manipulation detailliert zu beschreiben gewusst, indem sie Montage-, Maskierungs- und Umdeutungstaktiken von entlehnten Wendungen nachgewiesen hat, die sämtlich in Jux und Gaukelein gipfeln. Denn die eigentümliche Ununterscheidbarkeit der Quellen dieser Entlehnungen, ihre vollkommene Orientierung an der scheinbar eigene Sprache, ist für den Schriftsteller Mann ausschlaggebend.
„Jux“ und „Gaukelei“ strukturieren den Zauberberg also auf mehreren Ebenen. Sie treten in eigentümlichen Montagen der direkten Rede auf, die sich aus Kryptozitaten und Übernahmen speisen, und sie offenbaren sich im Erzählduktus, der nicht selten das Pathos im Gedankenstrom der Figuren bloßstellt. Auf der höchstmöglichen Ebene schließlich erweist sich der Roman, als Sammlung inkohärenter Erzähltechniken zur Beschreibung eines siebenjährigen Aufenthaltes, im Verlauf dessen der Protagonist weiterhin ein unbeschriebenes Blatt bleibt, selbst als Gaukelei. Er ist genauso perfekt umgesetzt, wie die Weltanschauungen und Ideen, von denen man ja eine Veränderung der Welt - oder zumindest ihrer Dynamik - erwarten würde. Paradoxerweise (auch dies eine Gaukelei des Autors) hängen Leser und Leserinnen eben an diesen Ideen wie an Hans Castorp und erwarten bis zum Ende gespannt Veränderung und Fortschritt. Daher eröffnet, die von Mann arrogant geforderte und von Adorno empfohlene Relektüre des ganzen Romans, in der Beschreibung der Gedankengänge des Helden, der stets Neues versucht und durch dieses Neue doch gänzlich unberührt bleibt, die Nuancen des Inneren bzw. konsequente Unveränderlichkeit des Protagonisten. In diesem Sinne ist der Zauberberg heute nicht nur ein Dokument seiner Epoche, ein eigentümliches Requiem für die Sanatoriumskultur vor dem Ersten Weltkrieg, wie Mann suggerierte, sondern vor allem ein Antidotum gegen die idee fixe von Bildung - vor allem mit Hilfe von Mentoren, Autoritäten oder abstrakten Ideen. Eine Mehrfachlektüre offenbart die immanente vielschichtige Gaukelei und ein mitleidloses Lachen, das die Ernsthaftigkeit dekomponiert; ein Lachen, das nicht nur Hierarchien, sondern den Lachenden selbst überfällt und überwältigt, wie Hans Castorp, als er, kaum am Bahnhof Davos-Dorf dem Zug entstiegen, über die Gepflogenheit, die Leichen mit Bobschlitten hinunterzubefördern hört: „Und plötzlich geriet er ins Lachen, in ein heftiges, unbezwingliches Lachen“ - jener Goethesche „sehr ernsten Scherz“, den Mann zitierte. Die Lektüre des Zauberbergs ist und bleibt ein Studium über das Lachen und Gaukeleien als Umgang mit konkretisierten, toten Ideen und dem ebenso toten Dogma des Fortschritts.