Sprechstunde – die Sprachkolumne
Haibun – oder wie mich mein Japanwissen das Humpeln lehrte

Unser neuer Kolumnist Jan Snela denkt an eine Japanreise, die einige Monate zurückliegt. Erinnerungen an Erlebnisse verweben sich dabei mit Gedanken an die Reiselektüre.
Von Jan Snela
Seit drei Monaten wieder zurück von meiner Japanreise frage ich mich: Welche Bücher hatte ich eigentlich dabei? Zwischen einer duty free erworbenen Sake-Flasche, einigen Päckchen dieser really Irresistible Rice Crackers and Peanuts, die man in jedem Combini (Japans Pendant zu den Spätis) kaufen konnte, einem Notizbuchblatt, auf dem mir Kimie, die Wirtin des Bed’n’Breakfast in Kamakura, ein Haiku Matsuo Bashōs in japanischen Zeichen, in alphabetischer Umschrift der japanischen Laute sowie in englischer Übersetzung notiert hat, vier aus dem Pachinko-Parlour in Nara entwendeten Eisenkugeln und Dutzenden, aus mir heute unerfindlichen Gründen aufgehobenen, Kassenbons, wühle ich vergeblich nach Anhaltspunkten. Auf keinem der vielen Zettelchen, von denen ich manche bekritzelt habe, findet sich auch nur die Spur eines Zitats, das mir darüber Aufschluss geben könnte.
Genug Ballast
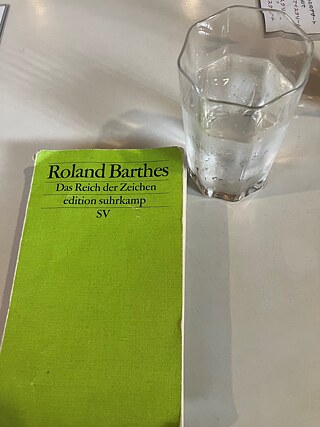
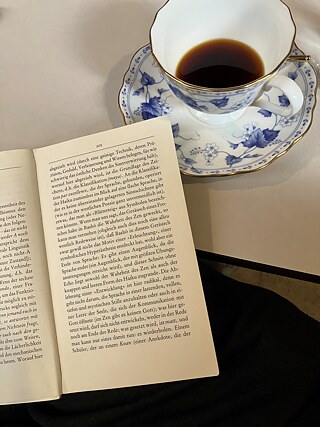
Ein altes Paar

Wie die beiden sich erst am Abend verhalten angeregt über die Fremden unterhalten würden, die tagsüber in ihren Laden gekommen waren = eine jener bei Ōe zu lesenden dialogischen Meditationen, zugefallene Zeichen als bedeutsame Spuren. Getrieben allerdings vom genauen Gegenteil des europäischen Wunsches, dem Rätsel oder Geheimnis irgendwann auf den Grund zu kommen.
Barthes, Philemon und Baucis
Zwei Stunden im Reich der Zeichen. Mit Rückenschmerzen. Ein Klassiksender am Grunde meines Gehörs. War das noch die okzidentale „innere Radiophonie, die das unausgesetzte Gespräch mit dem Selbst in Gang hält“ oder vernahm ich bereits den „Schnitt ohne Echo“ = das „Ende der Reden“? Fi-le-mon und Bao-tsi blieben für die Dauer meines Aufenthalts jedenfalls still.In Japan war ich übrigens, um meinerseits für ein Buch zu recherchieren. Um genauer zu sein: für einen Haibun. Ich würde gerne jetzt hier sofort noch etwas darüber erzählen. Aber das werde ich aufs nächste Mal vertagen. Vor vielen Jahren erzählte mir eine Japanerin auf einem Gartenfest, in Japan möge man es nicht, mehr als 60 Prozent einer Sache auszusprechen. Und was die für diese Kolumne veranschlagten circa 3.500 Zeichen angeht, bin ich schon bei deutlich über 100 Prozent.
Sprechstunde – Die Sprachkolumne
In unserer Kolumne „Sprechstunde“ widmen wir uns alle zwei Wochen der Sprache – als kulturelles und gesellschaftliches Phänomen. Wie entwickelt sich Sprache, welche Haltung haben Autor*innen zu „ihrer“ Sprache, wie prägt Sprache eine Gesellschaft? – Wechselnde Kolumnist*innen, Menschen mit beruflichem oder anderweitigem Bezug zur Sprache, verfolgen jeweils für sechs aufeinanderfolgende Ausgaben ihr persönliches Thema.