Magischer Realismus auf Deutsch
„Was man von hier aus sehen kann“ als gegenwärtiges Märchen von Mariana Leky

Die Natur hat etwas Magisches an sich und birgt abergläubische Vorstellungen, die den Ursprung für Märchengestalten und -geschichten bilden. Mariana Leky, die Autorin des Romans „Was man von hier aus sehen kann“ bekundet ihr Interesse für den Magischen Realismus und nimmt den Leser mit in die geheimnisvolle Welt zeitgenössischer Märchen.
Von Natalia Prüfer
Vermutlich ist dank Ihnen das Tier Okapi berühmt geworden. Vor allem in Ländern, in denen Ihr Roman veröffentlicht wurde (bis jetzt wurde er in mehr als 20 Sprachen übersetzt), also auch in Polen. Das Tier ist ein Symbol geworden. Eine Heldin – Selma träumt von Okapi, und dann ist es klar – jemand wird sterben. Ich möchte Sie aber nicht nur nach Okapi fragen, sondern allgemein nach der Natur. Die ist kein Hintergrund des Romans, sondern eine Heldin: Okapi, der große und sehr lange lebende Hund Alaska oder einfach ein Wald – ein Ort, mit dem alle Figuren sehr verbunden sind, egal ob sie dort jagen oder spazieren gehen. Was bedeutet für Sie Natur?

In dem anderen Roman von Ihnen, „Erste Hilfe“, gab es auch einen Hund – und auch sehr groß.
Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich ein persönliches Faible für große Hunde. Hunde eignen sich für mich gut als Metapher. In „Erste Hilfe“ war der Hund eine Metapher für sperrige Angst.
Und der Hund Alaska aus „Was man von hier aus sehen kann“? Der sollte eigentlich „Schmerz“ heißen, oder?
Ja, genau. Alaska eignet sich für mich auch als Metapher für Zeitlosigkeit. Über jemanden zu erzählen, der einfach nicht stirbt, das ist bei einem Tier unaufdringlicher, als wenn ich einen Menschen beschrieben hätte.
Der Westerwald, also der Ort, an dem der Roman spielt, ist ein deutsches Mittelgebirge, das sich über Bundesländer wie Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen erstreckt. Da gibt es wunderschöne Wälder, die zum Beispiel auch von den Brüdern Grimm bekannt sind. Sie haben die Legenden und abergläubischen Vorstellungen aus der Region gesammelt und einfach aufgezeichnet. Das nennen wir bis heute „Märchen“. Sie haben, Frau Leky, auch ein „Märchen“ geschrieben – „Was man von hier aus sehen kann“ ist ein Märchen des 21. Jahrhunderts. Ihr Roman ist aber viel sanfter, freundlicher, gewaltfrei. Haben Sie sich von den alten deutschen Märchen ein bisschen inspirieren lassen?
Das ist eine interessante Frage, da kommen wir wieder zur Natur. Die Natur hat hier etwas Magisches, und man kann sie gut mit Aberglauben besetzen. Das hat mich immer sehr interessiert. Gerade den Aberglauben, den man im Wald besonders unheimlich darstellen kann. Klar, das bezieht sich auf die Märchenhaftigkeit, besonders wenn da noch etwas Unheimliches drin steckt. Lustigerweise fällt mir das erst jetzt ein, wo Sie das sagen. Ich habe mich gar nicht bewusst auf die Brüder Grimm bezogen, ich habe mir das nicht vorgenommen. Aber Sie haben recht: Wald, Magie, Aberglaube – ich verstehe, was Sie meinen.
Ein deutscher Journalist hat Ihr Buch mit „Wir Kinder aus Bullerbü“ von Astrid Lindgren verglichen, und das ist ein Merkmal ihres Romans geworden. Sind Sie damit einverstanden?
Ich kann mir vorstellen, woher der Eindruck kommt, aber ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass in „Wir Kinder aus Bullerbü“ ein Kind stirbt. Diese Bullerbü-Assoziation kommt vielleicht daher, dass die Erzählerperspektive von Luise eine sehr freundliche und wohlwollende ist. Aber Bullerbü bedeutet für mich eine „heile Welt“, und die sehe ich in meinem Roman eigentlich nicht. Die Welt zerbricht nach dem Tod von Martin.
Statt „Wir Kinder aus Bullerbü“ würde ich Ihren Roman mit dem magischen Realismus vergleichen. Er ist zwar vielleicht mehr der lateinamerikanischen Literatur zugeordnet, aber solche Elemente, wie die Einbettung des Wunderbaren im Alltag, alter Aberglaube, die fantastische Welt der Natur, Symbolik und so weiter – das sind für mich auch in Ihrem Buch spürbare Motive. Hat Sie diese künstlerische Strömung inspiriert?
Ja, unbedingt – Volltreffer (lacht)! Ich mag es – als Leserin und als Autorin – sehr gerne, wenn magische Elemente in eine realistische Geschichte eingebettet und dann auch noch so behandelt werden, als ob sie normal wären. Ich wollte das unbedingt in meinem Buch machen.
Das haben Sie sehr gut gemacht. Wenn wir jedoch schon über Literatur für Kinder und Jugendliche wie „Wir Kinder aus Bullerbü“ sprechen, möchte ich fragen, ob Sie „Was man von hier aus sehen kann“ auch für junge Leser geschrieben haben? Oder vielleicht gerade für die ältere Generation? Ihr Buch verbindet diese zwei verschiedenen Gruppen durch Figuren wie Luise, Martin, Selma und den Optiker sehr gut.
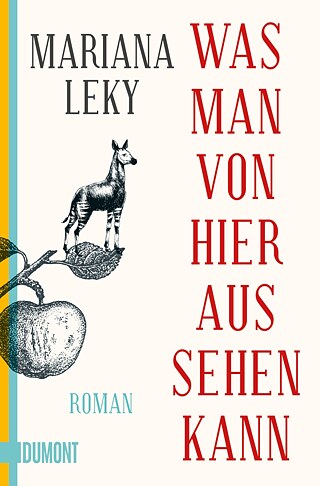
Die Helden Ihres Buches sind einander sehr nah. Sie wohnen in einem Dorf, sie kennen sich sehr gut, besuchen sich gegenseitig, helfen einander. Ist ein solcher Lebensstil auch in der Stadt möglich?
Ich denke, es wäre möglich, aber im Dorf leuchtet es mehr ein. Es lässt sich als dörfliche Gemeinschaft besser erzählen, aber ich kann mir fast vorstellen, dass das zu einem gewissen Grad auch in der Stadt möglich ist. Ich merke es hier im Prenzlauer Berg, der sich, gerade weil Berlin so riesig ist, wie ein kleines Dorf ausnimmt. Der Unterschied ist jedoch, dass man sich nicht so lange kennt.
Sie wohnen in Berlin, sind oft in Köln, aber Sie fahren auch manchmal in den Westerwald. Haben sich Ihre Gefühle geändert, nachdem Sie ein Buch geschrieben haben, dessen Handlung im Westerwald spielt?
Ja, es ist anders. Mein Buch ist gar nicht autobiografisch. Es gibt auch niemanden in dem Buch, den es wirklich gab. Ich habe auch keine Person, die ich kenne, abgeschrieben. Es ist aber trotzdem erstaunlich, dass ich, wenn ich in den Westerwald fahre, ihn jetzt anders sehe. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn für mein Buch neu erfunden habe. Ich habe ihn anders angelegt. Ich fühle mich wie in einer Werkstatt, wo ich etwas gebastelt habe.
Sie beschreiben alle Helden sehr warm und nett. Es ist schwierig, sie nicht zu mögen, obwohl sie vielleicht traurige Charaktere haben (wie Marlies) oder alkoholsüchtig sind (Palm). Sie haben schon erwähnt, dass die Figuren keine Vorbilder gehabt haben, aber wer stand Ihnen näher? Wen haben Sie mehr gemocht?
Das ist eine Mischung aus den beiden Alten, also Selma und dem Optiker, vielleicht sogar vor allem den Optiker.
Warum?
Ich weiß es nicht. Ich habe davor ein Buch geschrieben, das heißt „Die Herrenausstatterin“. Da kommt ein älterer Herr drin vor. Er spielt die zweite Hauptrolle und heißt Blank. Als ich das Buch „Was man von hier aus sehen kann“ geschrieben habe, dachte ich, ich verwandele ihn noch einmal, ich setze noch einmal etwas drauf und so entstand der Optiker. Für mich strahlt er so eine Güte aus, und das gefällt mir gut. Mir gefällt auch, wenn die Leute etwas Tröstliches haben, und der Optiker hat das. Es interessiert mich an ihm auch, dass er sich so wenig traut und in seiner ganzen Mutlosigkeit doch mutig ist. Diese charakterliche Konstellation hat mich interessiert.
Es gibt in dem Buch eine wunderschöne Szene, wie der Optiker die kleine Luise nach dem Tod von Martin tröstet. Er kann zwar nicht erklären, warum Martin gestorben ist, aber er erzählt, wie wichtig Luise für ihn ist. Das ist sehr berührend. Der Optiker war ein super Opa.
Ich habe meine beiden Großväter nie kennengelernt, sie sind vor meiner Geburt gestorben. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwo in mir drin und unbewusst eine kindliche Sehnsucht nach einem Großvater habe. Vielleicht habe ich mir einfach einen Großvater erfunden.
Wenn wir schon über ältere Zeiten und Opas sprechen … Man assoziiert die gegenwärtige deutsche Literatur meiner Meinung nach überwiegend mit dem starken, traurigen historischen Kontext: der Erste und der Zweite Weltkrieg oder danach das geteilte Deutschland. Die Handlung Ihres Buches passiert hier und jetzt, ist sehr universal. Der Leser bekommt nur einige kleine Tipps, also: Man bezahlt in D-Mark, es gibt noch keine Handys. War Zeit für Sie nicht relevant? Sind Geschichte und Politik für Sie unwichtig in der Literatur?
Ich beschäftige mich mit Politik und Geschichte, aber gerade bei diesem Buch war mir wichtig, dass es so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Das, was ich erzählen wollte, dazu brauchte ich etwas ganz Überschaubares, zeitlich und räumlich, deswegen also auch ein Dorf. Ich wollte das Dorf so zeichnen, dass es nicht unbedingt im Westerwald sein muss, es könnte auch woanders sein. Im Grunde ist die Zeit eigentlich egal. Ich habe es tatsächlich in die 80er Jahre gesetzt, weil ich kein Handy und keine E-Mails darin haben wollte.
Warum?
Weil ich wollte, dass Luise und Frederik es wirklich schwer haben, miteinander zu kommunizieren. Ich wollte, dass sie Briefe schreiben und dass es lange dauert, bis sie eine Antwort bekommen, vielleicht hat man eine schlechte telefonische Verbindung oder ein Brief ist verloren gegangen. Die Welt sollte in dem Buch einerseits rein gelassen werden, das Tagesgeschehen sollte draußen bleiben. Ich wollte, dass die Menschen in einer bestimmten Zeitlosigkeit stehen. Der deutsche Titel heißt „Was man von hier aus sehen kann“, und ich wollte gerade in der Liebesgeschichte von Luise und Frederik ergründen, wie viel man voneinander sehen kann, wenn man sich gar nicht sieht, wenn man also Briefe schreiben muss, wenn der andere nicht sichtbar ist. Ich wollte das erörtern.
Ihr Vater war ein Psychologe, der im Gefängnis gearbeitet hat, und die Geschichten von Gefangenen waren deswegen auch ein wichtiges Thema bei Ihnen zu Hause.
Meine Mutter war auch eine Psychologin. Die Geschichten von Gefangenen waren anwesend, aber vor allem die Geschichten von den Patienten. Meine Eltern haben uns nie Details erzählt oder Namen genannt – es war eher so, dass meine Eltern oft abends über ihre „namenlosen“ Patienten gesprochen haben. Wir durften das gar nicht hören, aber manchmal stand ich heimlich hinter der Tür und habe es angehört.
Sie leiten Schreibworkshops für Menschen, die im Gefängnis sind. Wie beeinflusst das Ihre Arbeit? Was kann man von den Gefangenen lernen?
Das ist eine sehr gute Frage. Normalerweise werde ich gefragt, was die Gefangenen von einer Schriftstellerin lernen können, aber umgekehrt ist das auch eine richtige Frage. Man kann zum Beispiel lernen, dass es manchmal reicht, einfach endlich einen Stift in die Hand zu nehmen. Sie müssen sich das vorstellen: Bei den Workshops sind oft Menschen, die noch nie eine Zeile im Leben geschrieben haben. Und ich habe immer erwartet, dass da eine große Hemmung kommt. Was mich aber beeindruckt hat, ist, dass die da mit einer unwahrscheinlichen Offenheit und ganz vorurteilsfrei reingehen. Sie setzen sich einfach hin, schreiben los und haben nicht, so wie ich, ständig diese Stimmen in Kopf, ob das interessant, spannend und gut ist. Das kann man später immer noch sehen, und das kann man von denen lernen.
Während der Pandemie waren solche Workshops wahrscheinlich nicht möglich, aber wie haben Sie überhaupt das letzte Jahr verbracht? Ist vielleicht ein neues Buch entstanden?
Das wäre schön, wenn es so wäre. Ich muss aber zuerst einmal sagen, dass ich riesiges Glück gehabt habe. Meine Lesereise mit dem Buch „Was man von hier aus sehen kann“ war schon vorbei. Anderen ist es wirklich schlecht gegangen, wenn sie zum Beispiel gerade ein Buch veröffentlicht hatten. Ich kenne die Situation, zu Hause zu arbeiten, ich mache das ständig, ich arbeite auch alleine, also war die Pandemie für mich keine Umstellung, aber mein Sohn war ständig zu Hause, und ich war eine Art Hilfslehrerin. Es war auch so, dass Corona uns das ganze Jahr über verfolgt hat. Es gab nie diese nötige Ruhe. Ich konnte natürlich etwas strukturieren und nachdenken, aber ich habe nicht wirklich angefangen, zu schreiben. Ich schreibe sowieso immer erst sehr spät.
Aber haben Sie schon eine Idee für ein neues Buch?
Ich würde sehr angeben, wenn ich sagte, ich hätte schon eine Idee. Es ist besser zu sagen, das ist eine ganz kleine, leise Idee.
Ein Ideechen?
Ja, ein Ideechen (lacht).
Stimmt es, das „Was man von hier aus sehen kann“ verfilmt wird?
Ja, ich bin sehr froh, weil gerade vor zwei Wochen die Nachricht kam, dass der Film fertig finanziert ist, und das bedeutet, es kann wirklich gedreht werden. Der Regisseur hat auch das Drehbuch geschrieben. Ich hatte damit nichts zu tun, und das wollte ich auch so. Ich halte sehr viel von ihm. Das ist ein toller, junger Regisseur. Er heißt Aron Lehmann. Ich glaube, dass es im Herbst losgehen soll.
Ich drücke die Daumen und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.