Sprechstunde – die Sprachkolumne
Ma, Mu und die Stille des Lärms
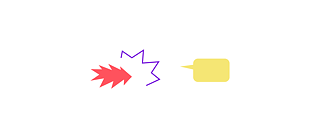
Jan Snela widmet sich den Schreien japanischer Zikaden, eingefangen in einem Bashō-Haiku. Seine Erinnerungen führen ihn zurück in die Geräuschkulisse Tokios. Eine überbordende Stadt – aber er findet dort ein Wort, das auf die Leere und die Abwesenheit verweist.
Von Jan Snela

Man sollte dazu wissen, dass die Japaner*innen von etwas völlig anderem reden als wir, wenn wir von Zikaden sprechen. Die klingen dort nämlich nicht wie das hiesige idyllische Feuerfangen der Luft. Eher wie eine Ufo-Landung. Wie Radioaktivität, wenn man die hören könnte. Wie Neue Musik. Von stiller Beschaulichkeit ist darin jedenfalls genauso wenig die Spur wie im Plärren der Screens von Shibuya oder im panischen Lärm der Pachinko-Höllen. Besagte Zikaden passen nur allzu gut in die japanischen Soundscapes, die von diversen Schrillheiten erfüllt sind. Und doch wird es in mir, wann immer ich mich gedanklich nach Japan wende, auf eine gleißende Weise still.
Damals in Tokio

Pachinkokugelnprasseln. Ein Bonsai spiegelt sich in der Glasfassade eines Wolkenkratzers, darin ein zeternder Spatz. Wie der Schrei der Zikaden tief in den Felsen eingedrungen. Wenn ich an damals in Japan denke, lausche ich ins Zwischen der Zeit. Dorthin, wo sich die Sekunden, Stunden und Wochen verbinden und trennen. Dafür gibt es ein japanisches Wort. Es lautet Ma (間), und bedeutet so viel wie Abstand, Dauer, die Leere dazwischen und Intervall. Die Silbe, die die Übenden in Zen-Klöstern seit Jahrhunderten beim Meditieren atmen (wenn sie nicht ihren Atem zählen) klingt fast genauso: Mu (無). Das heißt so viel wie Nein oder Nicht. Beides verweist auf ein in allen asiatischen Kulturen präsentes Moment der Abwesenheit statt postulierter Fülle des Seins.
Sinn für die Stille

In Japan – das hat eine weitere Privatumfrage ergeben – weiß kaum noch jemand um Zen. Die Beschäftigung damit weckt ein Befremden, wie es bei uns hervorgerufen würde, würden wir uns dazu bekennen, täglich den Rosenkranz zu beten. Aber mir scheint, dass die Japaner*innen bei aller Zufriedenheit mit ihren Geräuschkulissen einen tiefen Sinn für die Stille in sich tragen. Stille, nicht verstanden als etwas, das nach dem Schrillen käme, sondern als etwas, das daraus horcht.
Sprechstunde – Die Sprachkolumne
In unserer Kolumne „Sprechstunde“ widmen wir uns alle zwei Wochen der Sprache – als kulturelles und gesellschaftliches Phänomen. Wie entwickelt sich Sprache, welche Haltung haben Autor*innen zu „ihrer“ Sprache, wie prägt Sprache eine Gesellschaft? – Wechselnde Kolumnist*innen, Menschen mit beruflichem oder anderweitigem Bezug zur Sprache, verfolgen jeweils für sechs aufeinanderfolgende Ausgaben ihr persönliches Thema.