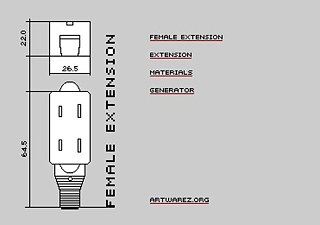Erinnerungskultur
„Gleichgültigkeit lässt sich nicht verbergen“

Für „Austerlitz“ hat Sergei Loznitsa Besucher von KZ-Gedenkstätten mit der Kamera beobachtet. Doch was kann Erinnerungskultur heute überhaupt leisten? Ein Gespräch mit dem ukrainischen Regisseur über seinen preisgekrönten Dokumentarfilm.
Herr Loznitsa, Sie leben seit vielen Jahren in Deutschland. Nach Dokumentarfilmen über die Ereignisse auf dem Maidan in Kiew oder den Putschversuch in Moskau 1991 haben Sie nun einen eindrucksvollen Film gedreht, der sich mit den Besuchern der KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen bei Berlin und Dachau bei München beschäftigt. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Ausgangspunkt war mein erster Besuch in einer solchen Gedenkstätte, in Buchenwald. Es war seltsam, ich wusste nicht, welche Position ich gegenüber diesem Ort einnehmen sollte. Das herauszufinden, war für mich der Anlass, den Film zu machen: Wie erlebe ich als Tourist einen solchen Ort? Denn diese ehemaligen Konzentrationslager sind einerseits Gedenkstätten und Friedhöfe, andererseits sind sie Lernorte, die vermitteln sollen, wie die Maschinerie der Vernichtung funktioniert hat.
Das lässt sich in Ihren Augen schwer miteinander vereinbaren?
Meiner Ansicht nach arbeiten diese zwei Seiten, Gedenkstätte und Lernort, gegeneinander. Und deshalb verhalten sich die Menschen dort merkwürdig. Denn an einem Ort des Gedenkens kann man eigentlich nur in sich gehen oder beten. Und dies widerspricht den Erwartungen an einen touristischen Ausflug zu einem „Lernort“. Eine andere Frage war für mich, ob es einem solchen Ort möglich ist, den erlebten Schrecken nachvollziehbar zu machen.
In „Austerlitz“ haben Sie ein sehr konsequentes ästhetisches Konzept umgesetzt. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Er besteht aus langen, klar komponierten Einstellungen. Es gibt keinerlei Kommentar oder Musikuntermalung und auch keine Interviews oder Zwischentitel. Das Publikum ist gefordert, sich das Gezeigte selbst zu erschließen.
Mir ist es in meiner Arbeit grundsätzlich sehr wichtig, dem Zuschauer Raum zu geben für seine eigenen Gedanken. Ich will meine Meinung nicht aufdrängen. Kino ist für mich, was sich in den Köpfen des Publikums abspielt. Die Ästhetik des Films zielt darauf, Distanz zu schaffen und das gefilmte Ereignis von seinen alltäglichen Kontexten, sozusagen aus dem Lebensfluss, herauszulösen. Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, die Dinge isoliert und genauer anzuschauen. Und das ist die Grundvoraussetzung, über etwas nachdenken zu können.
Ihr Film führt den touristischen Massenbetrieb an den Gedenkstätten eindringlich vor Augen: Die Sonne scheint, die Besucher tragen luftige Kleidung, Rucksäcke und Sonnenbrillen. Und fast alle sind mit Smartphones, Kameras oder Audioguides ausgerüstet. Man könnte annehmen, die Menschen würden ein Schloss oder einen Park besichtigen. Insgesamt erscheint diese Art von Massentourismus unangemessen für eine Gedenkstätte. Haben Sie den Film im Sommer gedreht, um dies zu betonen?
Ob sich die Menschen unangemessen verhalten oder nicht, das muss jeder Zuschauer für sich selbst entscheiden. Ich war der Ansicht, dass der Film im Sommer am besten funktioniert – weil dann die Dinge deutlicher ans Licht kommen. Das ist das Mittel der Hyperbel: Um etwas sichtbar zu machen, muss ich es verstärken. Aber im Grunde ist es nicht entscheidend, welche Kleidung die Menschen tragen. Gleichgültigkeit lässt sich nicht verbergen. Man erkennt sie an den Blicken.

Die Menschen, die ein früheres Konzentrationslager besuchen, werden dort mit dem Tod konfrontiert. Der Tod ist wie die Geburt ein Teil des menschlichen Kosmos. Aber in unserer Kultur ist er gemeinsam mit der Religion aus dem Leben verdrängt worden. Dass sich die Besucher so verhalten, wie es im Film zu sehen ist, hat sicher auch damit zu tun, dass sie nicht wissen, wie sie mit dem Tod umgehen sollen.
Es fällt auf, dass die meisten Besucher auf dem früheren KZ-Gelände fotografieren oder sogar Selfies machen. Besonders verstörend wirkt es, wenn Personen am Tor neben dem berüchtigten Satz „Arbeit macht frei“ posieren. Warum fotografieren sich die Leute an einem solchen Ort?
Dafür gibt es zweifellos viele Gründe, denn die Gedenkstätten werden ja auch von ganz verschiedenen Menschen besucht. Der Philosoph Zygmunt Bauman und die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Man kann sicherlich sagen, dass die Menschen an diesen Orten nach Möglichkeiten der Identifikation suchen. Normalerweise fotografiert man, um diese Erinnerung später mit jemandem zu teilen. Aber ob man ein Foto oder ein Selfie vor dem Schriftzug „Arbeit macht frei“ mit seinen Nächsten teilen möchte? Das ist eine spannende Frage. Für mich selbst war es übrigens sehr interessant zu sehen, welche Nationalitäten die ehemaligen Konzentrationslager besuchen. Man trifft dort außer Deutschen auch sehr viele Amerikaner, Australier, Italiener, Spanier – aber nur wenige Gruppen aus Osteuropa.

Im Bereich der ehemaligen Sowjetunion existieren kaum Gedenkstätten für den Holocaust. Nehmen wir als Beispiel Kiew: In Babyn Jar sind nach dem Einmarsch der Deutschen Zehntausende Juden erschossen worden. Erst in den 1970er-Jahren wurde dort ein erstes Denkmal geschaffen. Die Menschen haben sehr dafür kämpfen müssen.
Die Erinnerungskultur musste sich in Deutschland gegen viele Widerstände auch über Jahrzehnte entwickeln.
Wenn etwas so Grauenhaftes geschehen ist, muss man sich damit auseinandersetzen, man kann es nicht ignorieren. Heute weiß man, dass erlittene Traumen über Generationen weitergereicht werden. Ich halte es daher für sehr gefährlich, sich diesen Themen nicht zu stellen.