Kürzlich habe ich Maxim Billers Buch
Sechs Koffer (Kiepenheuer & Witsch 2018) aufgeschlagen, und als ich die ersten Seiten gelesen hatte, wusste ich sofort, dass ich diesen Kurzroman noch am selben Tag zu Ende lesen musste (genauer gesagt, habe ich ihn am nächsten Tag vor Sonnenaufgang beendet). Ich muss zugeben, dass ich das Buch eigentlich nur dank der tschechischen Übersetzung (übrigens eine sehr gute, übersetzt von Michael Půček) entdeckt habe, die 2021 bei Argo erschienen ist (und vom Goethe-Institut finanziell unterstützt wurde).
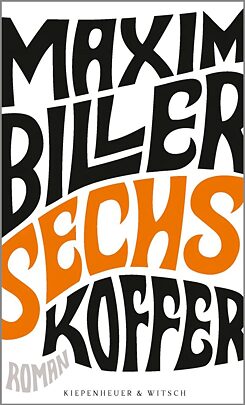 © Kiepenheuer & Witsch
© Kiepenheuer & Witsch
Maxim Biller ist ein etablierter deutscher Schriftsteller, der 1960 in Prag geboren wurde und aus einer russisch-jüdischen Familie stammt (was sich in seinen Texten auf unterschiedliche Weise widerspiegelt) und von der Kritik oft als literarisches
Enfant terrible bezeichnet wird: Aber was kann die Literatur anderes tun, als den Leser ‚zum Duell“ herauszufordern, ihn zu provozieren? Biller hat zahlreiche Kurzgeschichten und Romane geschrieben, in denen er kunstvoll die Grenze zwischen Fiktion und (Auto-)Biografie überschreitet (zuletzt z.B. der Roman
Biographie, 2016;
Sieben Versuche zu lieben, 2020;
Der falsche Gruß, 2021).
Die Handlung des Romans
Sechs Koffer - ganz kurz zusammengefasst - ist die allmähliche, komplizierte und immer wieder realitätskorrigierende Aufdeckung eines schwierigen Familiengeheimnisses: Wer hat den Tod des agilen und autoritären Oberhauptes einer jüdischen Großfamilie aus Russland verursacht? Wer war der Grund dafür, dass der Großvater Schmill Biller (aber niemand in der Familie nennt ihn anders als Tate) eines Tages auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo verhaftet und schließlich hingerichtet wurde? War der Verräter einer der vier Söhne (von denen einer der Vater des Erzählers ist), oder wurde der Tate von der schönen, aber geistig gestörten Tante Natalie verraten, einer jüdischen Überlebenden des KZ Theresienstadt, welche sich die Schuld am Tod ihrer eigenen Schwester gibt? Einer Tante Natalie, die sich selbst als „eine ewige, grinsende Puppe, die ihren Schmerz immer nur weglächelt" sieht (S. 143) und die sich unweigerlich in den Selbstmord treibt?
Billers Buch schildert das Schicksal einer jüdisch-russischen Familie im zwanzigsten Jahrhundert, deren Mitglieder sich nach und nach von der Sowjetunion über die Tschechoslowakei ins westliche Exil durchschlagen. Der unverblümt autobiografische Erzähler schildert alles (wie immer bei Biller) mit einem ungeheuren Maß an Empathie, Menschlichkeit und Humor, manchmal fast grotesk, aber zugleich ohne Skrupel; er fragt sich rückblickend, warum er „eigentlich so viel und so hart über [s]eine Familie schrieb“ (S. 174). Biller gelingt es, die Spannung aufrechtzuerhalten, indem er um das erwähnte Geheimnis und das Familientabu kreist und mit den klassischen Elementen von Erwartung und Enttäuschung arbeitet. Doch der Erzähler und Enkel des ermordeten Großvaters, der sich in einen Detektiv verwandelt, der auf der Suche nach dem „wahre[n] Mörder“ (S. 70) ist, erfährt paradoxerweise viel mehr, als er ursprünglich vorhatte. Er hat „endgültig genug von diesem ganzen Familienirrsinn“ (S. 135) und gibt sich selbst ein Versprechen: „Nie wieder [...] will ich ein Familiengeheimnis wissen, nie wieder will ich in fremden Schubladen kramen.“ (S. 103)
Billers Roman ist natürlich nicht nur eine künstlerische Reflexion über das verworrene Schicksal einer Familie (sicherlich interessant, aber relativ typisch für die Zeit und den Ort, d. h. das Europa des 20. Jahrhunderts), sondern auch ein unglaublich witziger und komplexer Spiegel der Zeit: „[D]iese[r] ganze stalinistische Irrsinn“ (S. 88), in dem die Familienmitglieder leben, jeder auf seine Weise, und aus dem sie, wiederum jeder auf seine Weise, zu entkommen versuchen. Darin spiegeln sich nicht nur die Gräueltaten der Nazis wider, sondern vor allem die Ungeheuerlichkeit des Kommunismus oder des Realsozialismus, dem auch antisemitische Ressentiments nicht fremd sind. Auf diese Weise entlarvt er aphoristisch den Kommunismus, der von Natur aus unmenschlich ist, weil er grundsätzlich „die Menschen nicht glücklich machen [kann]“ (S. 126), und reißt am Beispiel von Švejk (den sein Vater zu Beginn der Handlung ins Russische übersetzt) unverblümt die Maske des sowjetisierten (faschisierten) Menschen ab, der zynisch lachenden ‚Bestie‘, in die sich Menschen verwandeln, wenn sie unter unmenschlichen Regimen und Bedingungen überleben müssen.
Dieser Roman ist ein Beispiel für gute Literatur, der es gelingt, Unterhaltung und Spannung (eine Familienchronik mit Krimihandlung) mit einem farbenfrohen Spiegelbild der Zeit zu verbinden. Das Ergebnis ist ein manchmal wirklich schmerzhaftes und frustrierendes, aber oft kathartisches Abreißen der Maske, die man „das menschliche Gesicht‘ nennt, oder eine brutale Entromantisierung dessen, was man ‚das menschliche Herz“ nennt. Die Skepsis des Autors wird durch das Brecht-Zitat des Erzählers eingefangen, das in diesem Text als sarkastisches Kontrafaktum zu Biller dient (man möchte fast sagen: ‚wider Willen‚): „Ich glaube von jedem Menschen das Schlechteste, selbst von mir, und ich habe mich noch selten getäuscht“. (S. 86)
Die Seitenangaben der Zitate beziehen sich auf die 2. Auflage 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Berlin.
Autor: Lukáš Motyčka